BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
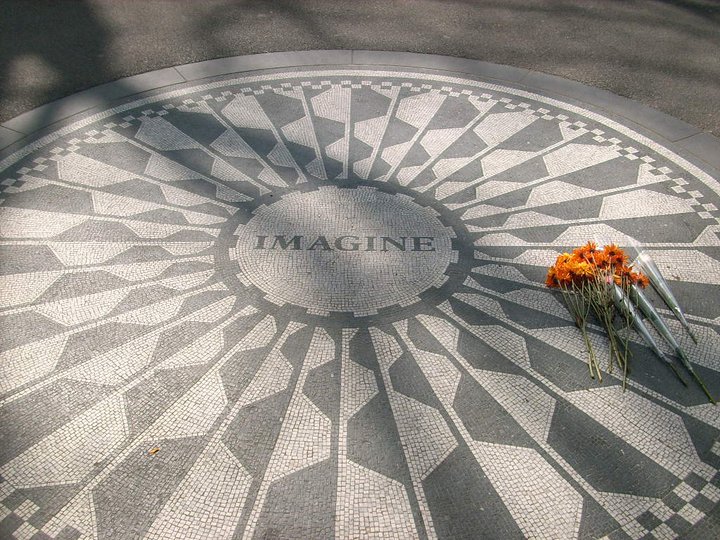
Bewertungen
Insgesamt 220 Bewertungen| Bewertung vom 31.10.2024 | ||
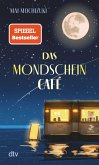
|
Das Mondscheincafé wird von Katzen betrieben, die ungleich klüger als ihre menschlichen Gäste sind. Es hat keinen festen Platz, sondern taucht in Nächten genau dort auf, wo Menschen sich in einer persönlichen Situation befinden, in der sie hilfreiche Ratschläge von außerhalb benötigen. |
|
| Bewertung vom 29.10.2024 | ||
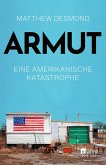
|
Es war einmal…Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo man angeblich vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen kann. Diese Zeiten sind längst vorbei. Mittlerweile ist die Zahl derjenigen, die von Armut betroffen sind, rasant angestiegen. „Mehr als 38 Millionen Menschen können ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen…mehr als eine Million Kinder im schulpflichtigen Alter sind obdachlos und leben in Motels, Autos etc.“ (Vorwort, S. 14). Ein Grund für Matthew Desmond, sich die Ursachen genauer anzuschauen. |
|
| Bewertung vom 28.10.2024 | ||
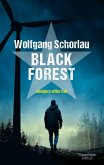
|
Black Forest / Georg Dengler Bd.11 In „Black Forest“, Band 11 der Georg Dengler-Reihe, schickt der Autor seinen in Stuttgart ansässigen Protagonisten zurück in das Dorf seiner Kindheit. Grund dafür ist ein Anruf der dortigen Polizei, die ihn davon in Kenntnis setzt, dass seine Mutter offenbar davon überzeugt ist, dass sich in der Nacht verdächtige Gestalten auf ihrem Hof herumtreiben. Ist seine Mutter in Gefahr oder gleitet sie allmählich in eine Altersdemenz ab? Beunruhigende Nachrichten, die dafür sorgen, dass er sich umgehend auf den Weg macht, auch wenn sich alles in ihm dagegen sträubt, in die Enge des Schwarzwaldes zurückzukehren, die er schon so lange hinter sich gelassen hat. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 26.10.2024 | ||
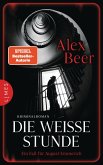
|
Die weiße Stunde / August Emmerich Bd.6 Wien 1923, die Zeit zwischen den Weltkriegen. Wien liegt am Boden, hat sich in einen Albtraum verwandelt. Die Wirtschaftslage ist katastrophal, die Inflation galoppiert, der Schwarzmarkt floriert, die Rattenfänger bekommen Zulauf. Hunger und Not bestimmen den Alltag, Angst und Verzweiflung greift um sich. Viele Menschen wissen nicht mehr aus noch ein, die Selbstmorde und ungeklärten Todesfälle häufen sich, die Opfer werden auf dem Friedhof der Namenlosen bestattet. |
|
| Bewertung vom 22.10.2024 | ||
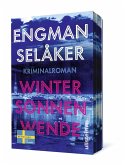
|
Wintersonnenwende / Wolf und Berg ermitteln Bd.2 „Wintersonnenwende“, das zweite Gemeinschaftsprojekt des schwedischen Autorenduos Pascal Engman und Johannes Selåker startet mit einem Prolog, in dem der Untergang des Ostsee-Fährschiffs Estonia 1994 thematisiert wird, bei dem 852 Menschen den Tod finden. Was dies, zumindest in Ansätzen, für die Handlung bedeutet, wird sich gegen Ende des Kriminalromans zeigen. |
|
| Bewertung vom 10.10.2024 | ||
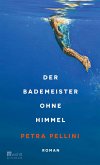
|
Romane, in denen die Hauptfigur an Demenz erkrankt ist, gibt es einige, aber selten hat sich ein Autor/eine Autorin diesem Thema mit so viel Empathie und Sachverstand wie Petra Pellini gewidmet. Das mag daran liegen, dass die Autorin, wie auf der Verlagsseite zu lesen ist, lange mit der Pflege dementer Menschen betraut war. |
|
| Bewertung vom 07.10.2024 | ||
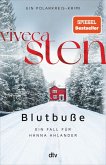
|
Blutbuße / Hanna Ahlander Bd.3 Die Vorgänger habe ich gerne gelesen, aber „Blutbuße“, dritter Band der Åre-Krimis von Viveca Sten, konnte mich leider nicht überzeugen. Warum? Ganz einfach in vier Worten auf den Punkt gebracht: Dünne Story, langatmig erzählt. |
|
| Bewertung vom 02.10.2024 | ||
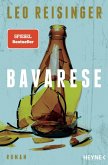
|
„Man trug Lederhosen oder Dirndl, man lebte umgeben von blauen Bergen und grünen Wiesen. Die menschenliebten dieses Land und seine Hauptstadt. Hier herrschte keine Not und keine Korruption (…) Doch manchmal waren die grünen Wiesen, auf denen die glücklichen Kühe weideten, mit Exkrementen befleckt.“ (Seite 97) |
|
| Bewertung vom 24.09.2024 | ||

|
Glasgow war schon immer ein gefährliches Pflaster. Als dort und in der Umgebung zwischen 1970 und 1980 zahlreiche Kohleminen, Stahlwerke und Werften geschlossen wurden, führte dies zu Massenarbeitslosigkeit und sozialem Elend. Im Gefolge davon kam es zu einem rasanten Anstieg der Kriminalitätsrate, was dazu führte, dass die schottische Großstadt schnell den Ruf hatte, „Crime Capital of Europe“ zu sein. Soweit der Hintergrund, vor dem Alan Parks Harry McCoy-Reihe einzuordnen ist, deren Startpunkt das Jahr1973 ist. |
|
| Bewertung vom 23.09.2024 | ||
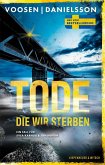
|
Tode, die wir sterben / Svea Karhuu & Jon Nordh Bd.1 2012 ist der erste Band der Reihe mit den Kommissarinnen Ingrid Nyström und Stina Forss erschienen. Neun weitere folgten, bis 2022 das erfolgreiche deutsch-schwedische Autorenteam Voosen/Danielsson mit „Die Spur der Luchse“ diese beendete und mit ihrem neuen Kriminalroman „Tode, die wir sterben“ den Startpunkt für die neue Reihe „Tatort Malmö“ setzen, deren inhaltliche Ausrichtung sich offensichtlich wesentlich stärker als die Vorgänger an den aktuellen gesellschaftlich-relevanten Problemen Schwedens orientiert. |
|
