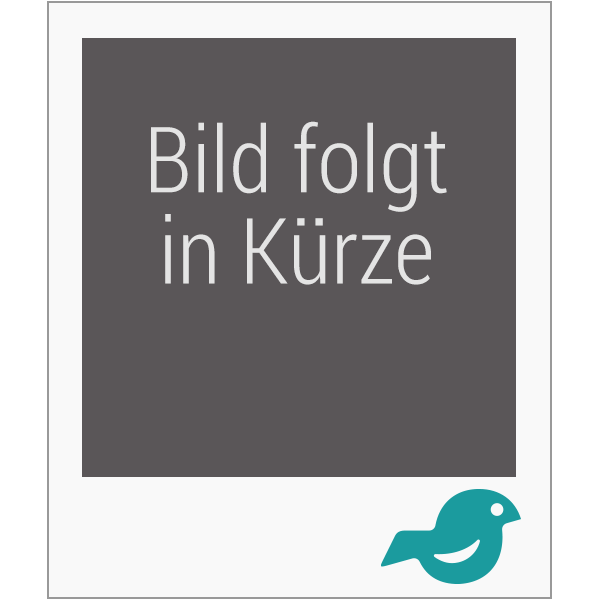Produktdetails
- Verlag: Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft
- ISBN-13: 9783534125463
- Artikelnr.: 06240576
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Naturvermeidung und Reisefreude im Spiegel der Kulturgeschichte
Eine klassische Walpurgisnacht. Sphinxe, Greife, Sirenen und Ameisen von der kolossalen Art geben sich ein Stelldichein. Mephisto: "Sind Briten hier? Sie reisen sonst so viel . . . Das wäre hier für sie ein würdig Ziel". Lange Zeit und nicht nur für Goethe haben die Briten als die obersten Touristen unter den Völkern gegolten. Das Reiseziel ist leicht beschrieben: "Outdoors", womit der gesamte Raum jenseits der eigenen Fußmatte gemeint ist, einerlei, ob es sich um die Nachbarschaft handelt oder um den Urwald, wo die Tiger brüllen.
Bereits im sechzehnten Jahrhundert gab Richard Hakluyt, ein Berater Elisabeths I., eine Sammlung von Reiseberichten heraus. Elisabeths Vater hatte den Schiffbau angekurbelt. Hakluyt pries die tapferen Briten: Andere Seevölker könnten sich auf den warmen Wogen des südlichen Atlantiks schaukeln, seine Landsleute hingegen hätten es mit der "tosenden, frostigen und nebligen" See des Nordens zu tun. Aufgehalten hat sie das nicht. Barbara Korte hat einen guten Überblick über die englische Reiseliteratur vom Mittelalter bis in unsere Tage verfaßt. Sie schreibt von Pilgerreisen, Entdeckungsreisen und Bildungsreisen, von Fernreisen und der "Home Tour", es gibt ein sehr interessantes Kapitel über reisende Frauen und eines über die Reise im zwanzigsten Jahrhundert.
Von der Grand Tour bis zur ersten touristischen Weltreise im Jahr 1872 war das britische Reisewesen der kontinentalen Konkurrenz um Schiffslängen voraus. Schon in der frühen Neuzeit waren Reiseberichte höchst beliebt. Daß es Kopffüßler gab und Menschen mit Hundsköpfen, wußte man bereits von Plinius. Daß im Fernen Osten Riesen lebten, auch kopflose Monster mit Augen in den Schultern sowie Leute, die sich unter ihren ausladenden Oberlippen in den Schatten legen konnten, war dank Marco Polo gut bekannt. Aber die dahergelaufenen Klugschwätzer, die von der östlichen Zivilisation prosaische Dinge erzählten, welche zum Bild vom wundersamen Asien einfach nicht paßten, lieferten sich dem ungläubigen Spott des gebildeten Publikums aus.
Über die Begleitumstände des Reisens waren die Briten nicht immer glücklich. Hakluyt monierte, daß seine kreuzfahrenden Landsleute Jerusalem demoliert hatten. John Byng, der verdrießliche Reisende schlechthin, beschwerte sich darüber, daß die Briten im eigenen Land nichts beim alten ließen: Die Wege wurden immer holpriger, die Herbergen immer teurer und das Essen täglich schlechter. Als Thomas Gray im achtzehnten Jahrhundert mit einer Kutsche durch den Lake District fuhr, soll er einmal die Fensterluke geöffnet und auf eine schüchtern sich erhebende Hügelkette geblickt haben: "Unnötige Beulen da draußen", befand der Dichter, die Luke wieder schließend. Hundert Jahre später war der Kunsthistoriker John Ruskin entsetzt darüber, wie seinesgleichen die Alpen verschandelte: "Unsere moderne Gesellschaft sucht die Bergwelt auf, . . . um zu picknicken, und läßt die Gletscher mit Hühnchenknochen und Eierschalen bedeckt zurück."
Wem die Natur als solche partout nicht zusagte (im frühen achtzehnten Jahrhundert zeugte das von Geschmack), der konnte einen "Claude-Spiegel" zur Hand nehmen, dessen konvexes, getöntes Glas die Landschaft so aussehen ließ, wie sie gefälligerweise hätte sein sollen: als Bild wie von Claude Lorrain oder Poussin gemalt. Eine andere Naturvermeidungsstrategie kam im zwanzigsten Jahrhundert in Schwang: Reiseziele wurden danach ausgesucht, wie exotisch das Beförderungsmittel war, auf dessen Rücken, Rädern, Kufen oder Flügeln man hin- und zurückgelangte, ohne sich mit dem Zielort sonderlich zu befassen.
Alle von Barbara Korte beschriebenen Reiseerfahrungen haben eines gemeinsam: Es sind Erlebnisse. Daß man Reiseberichte auch ganz anders auswerten kann, zeigt der englisch schreibende Österreicher Justin Stagl in seinem jüngsten Buch, einer "Geschichte der Neugier". Neugierig ist zunächst einmal der Leser, der versucht, einen Zusammenhang zwischen dem Thema "Reise" und Stagls Buch zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Stagls eigentliches Interesse gilt nämlich der Geschichte des Fragebogens im weitesten Sinne; er hat ein Faible für Fragebögen, die raschelnden Gehilfen der Bürokratie, die das Wissen vom eigenen Land und von fremden Völkern verwaltungsmäßig nutzbar machen.
Die Geschichte beginnt denn auch mit Moses, der die Kinder Israel in der Wüste antreten ließ, auf daß sie gezählt, geteilt und zugeordnet würden. Zweitausend Jahre vor unserer Zeit entstand die Diplomatie, eine sehr neugierige Disziplin; den Diplomaten auf dem Fuße folgten die nicht minder wissensdurstigen Geheimdienste. Im sechzehnten Jahrhundert brach dann die große Zeit der humanistischen Reiseanleitungen an, der Apodemiken, die dem Reisenden in Sub- und Sub-sub-Paragraphen beibrachten, wofür er sich zu interessieren habe. Was Moses, die Bürokratie der Antike, die Diplomatie und die Apodemiken in Stagls Darstellung gemeinsam haben, ist das Bestreben, Daten methodisch zu sammeln, sie zu sortieren, und abrufbar zu katalogisieren. Dem gleichen Ziel hätten auch die Akademien der frühen Neuzeit sowie die ersten Druck- und Verlagshäuser gedient.
Stagls Stil ist ein bißchen trocken. Aber wenn man einmal begriffen hat, daß es in seinem Buch nicht ums Reisen geht, sondern um das, was er "social research" nennt, dann kann man in seinem Text manch Lustiges entdecken, das da herausstökert wie die Baguette aus dem Einkaufskorb. Wenn ein Autor sich beim Wahren und Schönen überhaupt nicht aufhält, sondern Kultur als Datensammlung beschreibt, muß das Ergebnis komisch wirken. Die bedeutenden frühmodernen Akademien werden aus Stagls Blickwinkel zu "zusammengeschalteten Dokumentationszentren", und die Fragemethode des Sokrates ist von einer "Meinungsumfrage" kaum mehr zu unterscheiden.
Rösselspringend von der Antike bis zur Gegenwart, schreibt Stagl sich vom Großen zum Kleinen. Die Antike ist schnell abgehandelt, das Mittelalter bedauerlicherweise ein schwarzes Loch; die Reiseanleitungen der frühen Neuzeit und der humanistische Akademiebetrieb nehmen je ein Kapitel ein. Dann folgen biographische Porträts: Es gibt zum Beispiel ein Kapitel über George Psalmanazar, den Hochstapler, der vorgab, von Formosa zu kommen, wo man sich zur Kühlung lebende Schlangen um den Leib wickele. Ein anderes erzählt von dem österreichischen Grafen Leopold Berchtold, der versuchte, "die Gränzen der Wohlthätigkeit gegen Menschen unt Thiere zu erweitern". Auch der Göttinger Aufklärungshistoriker August Ludwig Schlözer wird vorgestellt, der Ahnherr der soziologischen Statistik.
Notabene haben alle diese Leute sich auch mit dem Reisen beschäftigt; aber das reicht nicht aus, Stagls Buch inhaltlich zusammenzuhalten. "Die Geschichte der Neugier" handelt von der Museumswelt und von der Welt als Museum, von Propheten, Prahlhänsen und Philanthropen und vom hungrigen, nimmersatten Interesse des Menschen an anderen Menschen. Stagl hat aufgetischt. Der Leser kann sich bedienen, er muß nur selbst die Arbeit leisten, das Angebot in seiner Vorstellung zu einer Einheit zu fügen. Wem das gelingt, der kann an dem originellen Buch sein Vergnügen haben. FRANZISKA AUGSTEIN.
Barbara Korte: "Der englische Reisebericht". Von der Pilgerfahrt bis zur Postmoderne. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1996. 236 S., Abb., kt., 48,- DM.
Justin Stagl: "A History of Curiosity". The Theory of Travel 1550 -1800. Harwood Academic Publishers, Chur 1995. 344 S., Abb., kt., 14,- brit. Pfund.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main