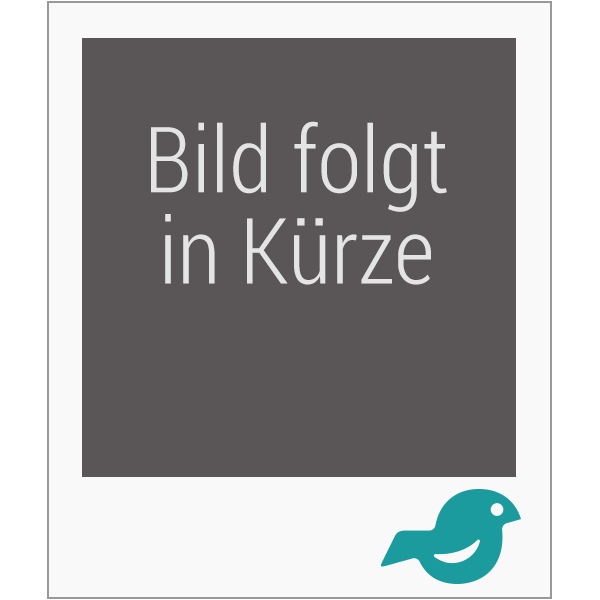Produktdetails
- Verlag: Fourth Estate / GB Gardners Books / HarperCollins UK
- Seitenzahl: 272
- Englisch
- Gewicht: 550g
- ISBN-13: 9781841155524
- ISBN-10: 1841155527
- Artikelnr.: 11109557
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Thales von Milet machte sein Vermögen mit Olivenpressen, die er auf Termin mietete - er sah eine besonders reiche Ernte und eine entsprechende Nachfrage voraus. Jene Philosophen unter uns, deren Ersparnisse sich beim Platzen der "Dotcom"-Börsenblase verflüchtigt haben, werden sich jedoch eher mit Isaac Newton oder Jonathan Swift vergleichen, die im Sommer 1720 Schiffbruch erlitten, als die sogenannte "Südseeblase" platzte. Newton etwa verlor 20 000 Pfund, die er sich vorher glücklich zusammenspekuliert, dann in Bargeld getauscht und dummerweise schließlich doch wieder in Aktien investiert hatte. Beide besaßen Anteile der 1711 gegründeten "Südsee-Gesellschaft". Diese Handelsgesellschaft versprach, gewaltige Profite zu erwirtschaften, indem sie seidene Handtücher oder Cheshire-Käse aus England oder Sklaven aus Afrika nach Südamerika exportierte. Jonathan Swift bildete zusammen mit Daniel Defoe die Speerspitze einer Propagandamaschine, die mit Geschichten vom sagenhaften Reichtum Südamerikas und seines unerschöpflichen Marktpotentials die Phantasien von Investoren aller Schichten des Volkes anstachelte. Am Ende blieb nichts. Nach ihrem Zusammenbruch verlegte sich die Südsee-Gesellschaft darauf, vor Grönland Wale zu jagen - doch Geld verdiente das Unternehmen nie. Die Philosophen der Meere waren weniger willig, die ihnen zugedachten Köder zu schlucken, als es die Aktionäre gewesen waren. Mit solchen Pointen ködert der britische Fernsehnachrichtenredakteur Malcolm Balen die Leser seiner Geschichte der Südseeblase ("A Very English Deceit". The Secret History of the South Sea Bubble and the First Great Financial Scandal. Fourth Estate, London 2002. 260 S., Abb., geb., 17,99 brit. Pfund). Typischerweise kommt das Buch mit drei Jahren Verspätung auf den Markt - alles andere wäre ja Kassandra-Marketing gewesen. Warnen vor eigener Dummheit kann es uns nicht mehr, und es erwähnt auch nicht die Chancen, die sich dem kühlen Rechner nach Zusammenbrüchen bieten. Balen schildert die politischen Verwicklungen dieses Betrugsskandals, mit dem die britische Regierung ihre in den Kriegen gegen Frankreich angehäuften Schulden loswerden wollte, indem man die Anleger dazu brachte, ihre sicheren Staatsanleihen gegen inflationierte Aktien eines Unternehmens zu tauschen, das operativ gar nicht tätig war. Und die Betrüger waren so erfolgreich, daß sie sogar auf ihren eigenen Schwindel hereinfielen. Darüber schreibt Balen sehr unterhaltsam. Aber die Parallelführung zur Internetblase unserer Tage, die er durch aktuelle Zeitungszitate herstellt, führt nur zur Gier als bleibendem Stempel der menschlichen Natur. Ein deutscher Autor hätte den schlagenden Vergleich zum Börsengang der Deutschen Telekom gezogen, die mit einer Eigenkapitalrendite von 4,12 Prozent und einer Eigenkapitalquote von siebenundzwanzig Prozent schon 1996, im Jahr des Börsengangs, nicht gerade sexy wirkte, aber unverantwortlicherweise zur "Volksaktie" hochgejubelt wurde - in einem deregulierten, heftig umkämpften Markt, der keine Aussicht auf Gewinnwachstum bot. Bei einem Ausgabepreis von 14,57 Euro betrug der Koupon etwa 4,8 Prozent. Zehnjährige Staatsanleihen rentierten zur selben Zeit mit 5,77 Prozent, allerdings vor Steuern. Kriminell jedoch wird das Ganze, wenn man an die mörderischen Preise denkt, zu denen die UMTS-Lizenzen versteigert wurden, damit Finanzminister Eichel das Staatsdefizit ein Stück weit abbauen konnte. Nicht zuletzt auf Kosten der T-Aktionäre wurden wie im Südseeschwindel öffentliche Schulden in private umgewandelt. Die dem staatlichen Handeln innewohnende kriminelle Energie mag eine kulturgeschichtliche Konstante sein. Dennoch wird man kaum Bundeskanzler Kohl mit dem in John Gays "Bettleroper" als "Räuber-Bob" figurierenden Premierminister Robert Walpole und Ron Sommer mit dem betrügerischen Aufsteiger John Blunt vergleichen wollen, der als Bankier und Unternehmensgründer Schmiergeld als wichtigstes Zahlungsmittel benutzte. Ohne Vergleich ist nur Gerhard Schröder, der die im Telekom-Fahrwasser hochgejubelte und jetzt auf UMTS aufgelaufene Mobilcom bis zur Wahl mit zunächst fünfzig Millionen Euro über Wasser hielt. An die bunte Finsternis dieser Gestalten, denen Balen schöne Kapitel widmet, reicht das heutige Personal nicht heran. Das gilt schließlich auch für den T-Propagandisten Manfred Krug. Er ist kein zweiter Jonathan Swift, dessen "Gulliver" die "Besserung der Yahoo-Rasse" versuchte, nachdem er schiffbrüchig ins Land Liliput abgehauen war.
CHRISTOPH ALBRECHT
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main