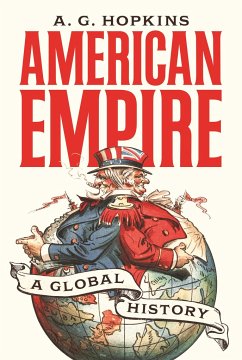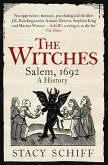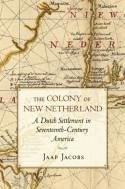"Compelling, provocative, and learned. This book is a stunning and sophisticated reevaluation of the American empire. Hopkins tells an old story in a truly new way--American history will never be the same again."--Jeremi Suri, author of The Impossible Presidency: The Rise and Fall of America's Highest Office.Office.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno