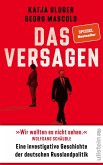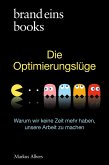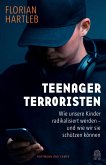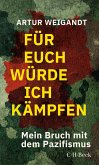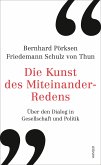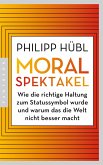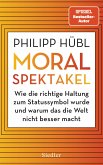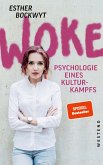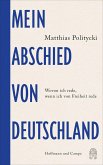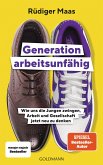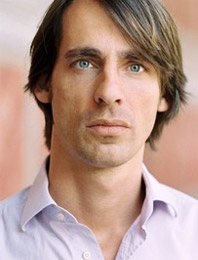»Das Thema Meinungsfreiheit ist zu wichtig und zu dringend, um es den Rechtspopulisten zu überlassen.«
Studien zufolge ist mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung der Ansicht, ihre Meinung nicht mehr frei äußern zu können. Woran liegt das? Je mehr Menschen heute ihre Individualität ausdehnen und die Dinge 'persönlich' nehmen, umso leichter fühlen sie sich gekränkt. Beschleunigt durch Social Media und die Möglichkeiten des Shitstorms wird das Risiko freier Meinungsäußerungen immer größer und die sozialen Kosten steigen gefährlich an. In der Folge gerät unsere Gesellschaft in einen Angststillstand. Denn wie sollen eine beherzte Politik, eine provozierende Kunst und eine gesellschaftskritische Kultur noch möglich sein, wenn immer jemand empört oder verletzt reagiert?
Richard David Precht entwickelt ein gesellschaftliches Psychogramm und nimmt uns in die Pflicht, das »Wir« wieder in den Vordergrund zu stellen.
Studien zufolge ist mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung der Ansicht, ihre Meinung nicht mehr frei äußern zu können. Woran liegt das? Je mehr Menschen heute ihre Individualität ausdehnen und die Dinge 'persönlich' nehmen, umso leichter fühlen sie sich gekränkt. Beschleunigt durch Social Media und die Möglichkeiten des Shitstorms wird das Risiko freier Meinungsäußerungen immer größer und die sozialen Kosten steigen gefährlich an. In der Folge gerät unsere Gesellschaft in einen Angststillstand. Denn wie sollen eine beherzte Politik, eine provozierende Kunst und eine gesellschaftskritische Kultur noch möglich sein, wenn immer jemand empört oder verletzt reagiert?
Richard David Precht entwickelt ein gesellschaftliches Psychogramm und nimmt uns in die Pflicht, das »Wir« wieder in den Vordergrund zu stellen.
Ein etwas chaotisches, nicht immer sauber erarbeitetes, aber in der Zielrichtung teils durchaus sympathisches Buch liest Rezensent Jens Hacke. Der Pop-Philosoph Richard David Precht arbeitet sich hier, fasst Hacke zusammen, an dem gefühlten Verlust an Meinungsfreiheit ab, den es ernst zu nehmen gelte. Prechts Argumentation führt, so Hackes Zusammenfassung, zurück zu den 68ern, die die Hoffnung auf gesellschaftliche Umwälzungen in Selbstoptimierungsmaximen und vor allem einen seither grassierenden Moralismus umformten, was dem Autor nicht gefällt. Precht beschäftigt sich kaum mit aktueller Forschungsliteratur, was Hacke nicht so schlimm fände, wenn er die Thesen der Klassiker von Aristoteles bis Tocqueville, die er stattdessen herbei zitiert, wenigstens korrekt wiedergeben würde, was oft nicht der Fall ist. Amüsiert zeigt sich der Rezensent außerdem über Wortschöpfungen wie "Axolotlisierung" - gemeint ist das Infantilwerden aktueller Diskurse. Die Schlagrichtung gegen woke und für offene, scheuklappenfreie Diskurse, auf die das Buch zusteuert, gefällt Hacke allerdings durchaus. Insgesamt also, schließt die Besprechung, ein oft eher wirres Buch, das dennoch einige sinnvolle Anregungen erhält.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH