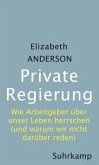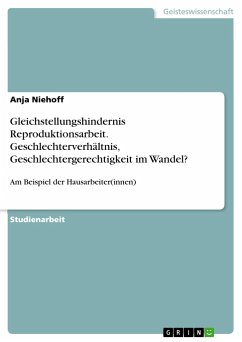Zeit ist seit jeher ein umkämpftes Terrain und ihre Verteilung wird häufig als »Maß der Freiheit« verstanden. Wie viel Zeit wird für Erwerbs- und Reproduktionsarbeit aufgewendet, wie viel steht zur freien Verfügung? Der Sammelband nimmt aus soziologischer und zeitgeschichtlicher Perspektive die gewerkschaftliche Forderung nach Arbeitszeitverkürzungen seit den 1970er Jahren auf breiter Quellenlage in den Blick und skizziert Debatten um betriebliche Arbeitszeiten ebenso wie um Reproduktions- und Care-Arbeit. Konflikte um Arbeitszeiten haben viele Dimensionen. Denn die alltägliche Lebensführung der Beschäftigten wird nicht nur durch die Regulierung der Dauer, Lage und Verteilung von Arbeitszeit beeinflusst, sondern auch durch Verdichtung und Flexibilisierung und Anforderungen von Care-Arbeit. Für Gewerkschaften war und ist es eine ständige Herausforderung, diese Dimensionen in Zeitpolitiken umzusetzen. Debatten früherer Jahrzehnte bieten Ansatzpunkte für aktuelle Konflikte um Arbeitszeit.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno