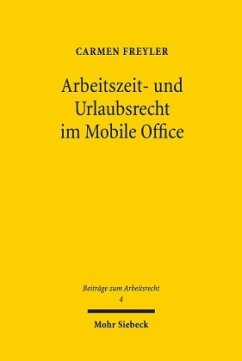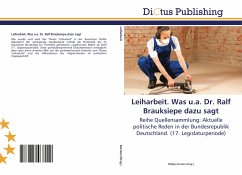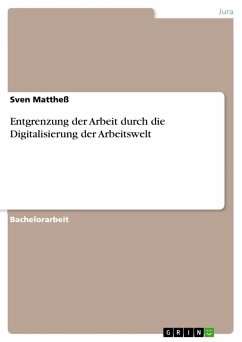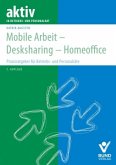Die betriebliche Nutzung mobiler Kommunikationsgeräte erlaubt die Erbringung von Arbeitsleistungen an jedem Ort und zu jeder Zeit. Das wirft arbeitszeit- und urlaubsrechtliche, aber auch grundlegende Fragen dazu auf, ob das Arbeitsrecht in seiner bestehenden Gestalt in der Lage ist, moderne Sachverhalte normativ zu erfassen. Carmen Freyler untersucht die rechtliche Qualität von ständiger Erreichbarkeit und mobilen Arbeitsleistungen im Hinblick auf den Arbeitszeitbegriff, die Bedeutung hoher Arbeitszeitsouveränität des Arbeitnehmers bei der Einhaltung von Höchstarbeits- und Ruhezeiten sowie die Auswirkungen gestörter Erholungsmöglichkeiten auf die Erfüllung des Urlaubsanspruchs. Daneben arbeitet sie den durch die Arbeit 4.0 verursachten Reformbedarf vor dem Hintergrund des europäischen Rechts heraus und bietet Lösungsansätze für eine maßvolle Weiterentwicklung tradierter Grundsätze. Die Arbeit wurde mit dem Universitätspreis der Gesellschaft der Freunde der Universität Augsburg 2018 und dem Wissenschaftspreis der Stiftung Theorie und Praxis im Arbeitsrecht (Wolfgang Hromadka Stiftung) 2019 ausgezeichnet.

Erläuterungen zum mobilen Büro
Nach klassischer Definition des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 1961 ist Arbeit jede Tätigkeit, die der Befriedigung eines fremden Bedürfnisses dient. Dabei kann Arbeit sowohl körperlicher als auch geistiger Natur sein. Doch trägt diese Begriffsbestimmung heute noch? Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen, nicht zuletzt dadurch, dass immer mehr Arbeit zu Hause oder unterwegs erbracht wird. Die klassische und klare Rollenverteilung - tagsüber Arbeitnehmer, abends und am Wochenende Privatperson - gerät ins Wanken.
Arbeitnehmer lesen an Sonntagen E-Mails, können dafür Werktage selbst organisieren und zwischendurch einkaufen. Freilich entsteht dadurch kein turbokapitalistisches El Dorado, in dem alles erlaubt und möglich ist. Das deutsche Arbeitsrecht, inzwischen stark geprägt von europäischen Einflüssen, reagiert und zieht immer wieder neue Grenzen. Dass das mit den vorhandenen gesetzlichen Regelungen auch möglich ist, zeigt Carmen Freyler in ihrer Arbeit zum "Arbeitszeitrecht und Urlaubsrecht im Mobile Office".
Die Augsburger Wissenschaftlerin erklärt, dass - ausgehend vom Grad der Belastung und der Intensität der Anspruchnahme - unterschieden wird zwischen Vollarbeit, Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft und Ruhezeit. Im Einzelnen: Vollarbeit ist der Regelfall. Sie ist auch gegeben, wenn eine Verkäuferin im Laden auf Kunden wartet. Denn entspannen kann sie sich nicht. Arbeitsbereitschaft meint eine geringere Belastung, etwa die Wartezeit des Rettungspersonals zwischen zwei Einsätzen.
Auch diese Zeit zählt zur Arbeitszeit. Bereitschaftsdienst bedeutet, dass sich der Arbeitnehmer an einer bestimmten Stelle aufzuhalten hat, um erforderlichenfalls seine Tätigkeit aufnehmen zu können. Dazu gehören Ärzte. Ursprünglich galt das nicht als Arbeitszeit. Im Jahr 2000 entschied der Europäische Gerichtshof anders, und das Arbeitszeitgesetz wurde aktualisiert. Die vorletzte Kategorie der Rufbereitschaft verlangt ebenfalls die Möglichkeit der raschen Arbeitsaufnahme, schreibt aber keinen bestimmten Aufenthaltsort vor. Diese Zeit zählt zur Ruhezeit, die hier die letzte Kategorie darstellt. Hier kann der Arbeitnehmer komplett über seine Zeit verfügen. Ruhezeit ist somit das Gegenteil von Arbeitszeit.
Wozu gehört nun das "Mobile Office"? Freyler versteht darunter Büroarbeit, die an jedem beliebigen, von einem festen Arbeitsplatz unabhängigem Ort außerhalb des Betriebs zu jeder Zeit mittels mobiler Kommunikationsgeräte und drahtloser Datenübertragung erfolgen kann. Was ist aber mit der Zeit einer konkreten Erreichbarkeit im Mobile Office? Gestritten wird, ob diese Form Bereitschaftsdienst (also Arbeitszeit) oder Rufbereitschaft (also Ruhezeit) ist, wenn sie an Werktagen, einschließlich Samstagen, stattfindet.
Die Entscheidung hat Auswirkungen auf die Höchstarbeitszeit sowie erforderliche Ruhepausen. Für das Entgelt hat die Einordnung dagegen keine unmittelbare Relevanz, denn hier gelten Arbeits- und Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen. Im Fall des konkreten mobilen Büros plädiert Freyler - arbeitgeberfreundlich - für die Annahme einer Rufbereitschaft: "Das Mitführen eines empfangsbereiten Smartphones führt nicht zu einer vergleichbaren Schmälerung der Freiheit des Arbeitnehmers wie beispielsweise der zwingende Aufenthalt eines Arztes im Ruheraum des Krankenhauses während des Bereitschaftsdienstes. Der Arbeitnehmer kann bei der Erreichbarkeit im Mobile Office privaten Aktivitäten nachgehen und sich räumlich frei und vor allem im persönlichen Umfeld bewegen."
Hat der Arbeitnehmer sogar nur ein Mobiltelefon bei sich, ohne für einen bestimmten Zeitraum oder bezogen auf ein bestimmtes Ereignis erreichbar zu sein, handelt es sich nur um eine Ruhezeit. "Zeiten bloßer Erreichbarkeit stehen nicht in Konflikt mit den Vorschriften zur Höchstarbeitszeit und Ruhezeit sowie dem Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit. Die Kontrolle des elektronischen Posteingangs zählt zur bloßen Erreichbarkeit", schreibt die Verfasserin.
Kurz nach Erscheinen von Freylers Ausarbeitung entschied der Europäische Gerichtshof im Februar 2018, dass Ruhezeiten zur Arbeitszeit gehören, wenn der Betroffene sofort einsatzfähig sein muss. Im konkreten Fall ging es um einen Feuerwehrmann aus Belgien. Unterliege der Arbeitnehmer der Verpflichtung, dem Ruf des Arbeitgebers innerhalb kurzer Zeit Folge zu leisten, schränke das seine Möglichkeit erheblich ein, sich anderen Tätigkeiten zu widmen. Daher sei auch eine "passive" Rufbereitschaft Arbeitszeit, wenn der Arbeitgeber zeitliche und/oder geographische Vorgaben macht, die eine Freizeitgestaltung einschränken.
Der Feuerwehrmann musste innerhalb von acht Minuten auf seiner Rettungsstelle sein können. Diese Verpflichtungen werden die meisten Menschen in einem Mobile Office wohl nicht haben. Deshalb kann man hier - wie Freyler auch darlegt - von Ruhezeiten ausgehen: "Der Schutz der Gesundheit des Arbeitnehmers hat keinen generellen Vorrang vor der Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen. Eine Kollision der Ziele ist durch eine einzelfallbezogene Abwägung aufzulösen."
Natürlich unterbrechen konkrete Arbeitsleistungen, die dann im mobilen Büro erbracht werden, die Ruhezeit. "Geringfügige Unterbrechungen lösen allerdings keinen Neubeginn der Ruhezeit aus." Was aber ist geringfügig? Nach Freyler darf keine beachtliche Belastung des Arbeitnehmers entstehen, und die Unterbrechungen dürften nicht wiederholt auftreten. Gesetzlich definiert ist das bisher nicht. Freylers Arbeit zeigt überzeugende Lösungen für die Rechtsfragen um das Mobile Office in einer globalisierten Welt. Doch der Urlaub ist auch ihr heilig: Während des gesetzlichen Mindesturlaubs sei der Arbeitnehmer nicht einmal verpflichtet, erreichbar zu sein. Daran könnten auch Tarifverträge nichts ändern.
JOCHEN ZENTHÖFER
Carmen Freyler: Arbeitszeit- und Urlaubsrecht im Mobile Office, Mohr Siebeck, Tübingen 2018. 328 Seiten. 89 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main