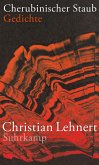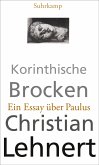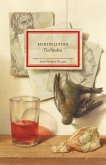"Wie ein Buchstabe, / aufgerissenes Auge, nicht von dem Buch wissen kann, / das ihn enthält, / kann ich nicht lesen, wo ich bin."Sie stellen sich den Fragen nach der eigenen Existenz: der Bausoldat, der sich in der monotonen Plackerei auf Rügen zwischen "Gleichschritt" und "Normzeit" abhanden zu kommen droht; der Anpassungsvirtuose Erich Mielke, für den das Wort Ich ein "bloßes Stochern im Dunkel" ist; oder Apostel Paulus, der auf das Kommende vertraut und das Hier und Jetzt als Zwischenzustand begreift.Auf Moränen erklingen diese Stimmen, unter ihnen ein Berg von Erlebnissen und Geschichte, Gedankengeröll, das sich übereinanderschiebt. Christian Lehnert spürt in seinen Gedichtzyklen tastend, drängend den Identitätsfragen nach, wie sie vom Urchristentum bis in die Gegenwart reflektiert werden, und entfaltet "ein Wortgewebe voll dunklem Glanz" (Gerhard Kaiser).
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno