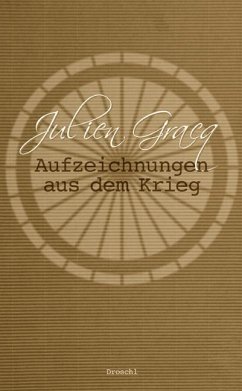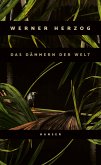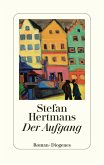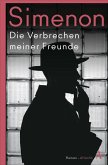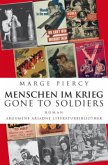Als 2011 die "Manuscrits de Guerre" aus Julien Gracqs Nachlass erschienen, wurden sie in Frankreich sofort zu einem literarischen Ereignis - die Neugier, von diesem eigensinnigen und unbeirrbaren Meisterstilistiker endlich auch ein authentisches "privates" Zeugnis lesen zu können, machte diese Aufzeichnungen zu einem der meistgelesenen Bücher des Jahres.
Julien Gracq beschreibt in diesem Journal seine Zeit als Leutnant vom 10. Mai bis zum 2. Juni 1940 in Flandern, wenige Kilometer entfernt von Dünkirchen. Und er beschreibt sie gewissermaßen in zwei Genres, einmal als unmittelbare Tagebuch-Aufzeichnungen - und, in einem zweiten Heft, verwandelt in eine klassische Erzählung. Seine Sätze sind, schon am Beginn seiner literarischen Laufbahn (erschienen war bis dahin erst der kleine Roman Auf Schloß Argol, 1938), von bemerkenswerter Präzision und einer sinnlichen Schärfe, die sogar die tristen Ereignisse des Soldatenalltags magisch zu verwandeln imstande ist. Gracqs Schilderung vermittelt sowohl die ungeheuer spannende Situation vor Ort, als auch das lächerliche und nervenbelastende Warten in diesem "Kriegsspiel", das ja die zentrale Erfahrung in den großen Romanen Gracqs (Das Ufer der Syrten, Der Balkon im Walde) darstellt.
Julien Gracq beschreibt in diesem Journal seine Zeit als Leutnant vom 10. Mai bis zum 2. Juni 1940 in Flandern, wenige Kilometer entfernt von Dünkirchen. Und er beschreibt sie gewissermaßen in zwei Genres, einmal als unmittelbare Tagebuch-Aufzeichnungen - und, in einem zweiten Heft, verwandelt in eine klassische Erzählung. Seine Sätze sind, schon am Beginn seiner literarischen Laufbahn (erschienen war bis dahin erst der kleine Roman Auf Schloß Argol, 1938), von bemerkenswerter Präzision und einer sinnlichen Schärfe, die sogar die tristen Ereignisse des Soldatenalltags magisch zu verwandeln imstande ist. Gracqs Schilderung vermittelt sowohl die ungeheuer spannende Situation vor Ort, als auch das lächerliche und nervenbelastende Warten in diesem "Kriegsspiel", das ja die zentrale Erfahrung in den großen Romanen Gracqs (Das Ufer der Syrten, Der Balkon im Walde) darstellt.