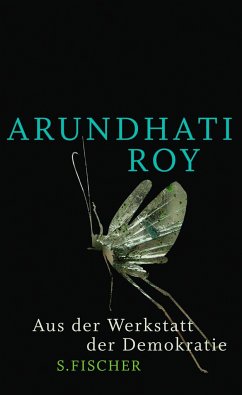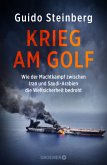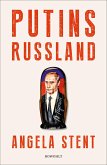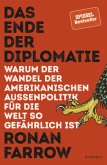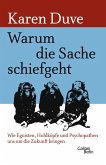Arundhati Roy ist eine der faszinierendsten Romanautorinnen Indiens und eine seiner mutigsten Frauen. Unbeirrt und mit Verve führt sie uns vor Augen, wie es unter der glänzenden Oberfläche des Subkontinents wirklich aussieht - fernab mystischer Verklärung und den bunten Lichtern Bollywoods.
Mit leidenschaftlicher Überzeugung, gründlicher politischer Analyse und einer wunderbar poetischen Sprache spricht sie in ihren Essays über religiöse und politische Ausgrenzung, über kulturelle wie wirtschaftliche Missstände. Kühn stellt sie sich den aktuellen Ereignissen der letzten Jahre - wie dem Pogrom gegen die Muslime in Gujarat 2002 oder den gewalttätigen Ausschreitungen in Mumbai 2008.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Mit leidenschaftlicher Überzeugung, gründlicher politischer Analyse und einer wunderbar poetischen Sprache spricht sie in ihren Essays über religiöse und politische Ausgrenzung, über kulturelle wie wirtschaftliche Missstände. Kühn stellt sie sich den aktuellen Ereignissen der letzten Jahre - wie dem Pogrom gegen die Muslime in Gujarat 2002 oder den gewalttätigen Ausschreitungen in Mumbai 2008.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Eine Reise ins dunkle Herz Indiens
Bei den maoistischen Partisanen: Arundhati Roy zwischen Romantik und Realismus
SANTINIKETAN, 9. Mai
Seit Jahren geht das Gerücht, Arundhati Roy schreibe an einem zweiten Roman. Doch hat die Autorin seit dem phänomenalen Erfolg des 1997 erschienenen "Der Gott der kleinen Dinge" ausschließlich Essays und Reden verfasst, die sie als Aktivistin für die Interessen der Stammesangehörigen in Zentralindien, gegen Big Business und die multinationalen Konzerne, gegen den wirtschaftlichen Imperialismus der Vereinigten Staaten ausweisen. Jahrelang kämpfte sie mit der Feder gegen die großen Staudämme im Narmada-Tal. Man musste allerdings häufig bezweifeln, dass ihre Schlussfolgerungen stimmten, denn sie bereitete Fakten und Zahlen lieber suggestiv als wissenschaftlich auf. So traute Roy sich Urteile über weltpolitische Zusammenhänge zu, wobei man den Eindruck unzulässiger Vereinfachung nie ganz abschütteln konnte.
Nun hat Arundhati Roy einen langen Essay vorgelegt, eigentlich einen Reisebericht, der konkret und persönlich bleibt und darum nach dem Roman ihr überzeugendster Prosatext ist. Er beschreibt eine Reise ins dunkle Herz Indiens, in die von Partisanen besetzten Wälder und Höhenzüge im zentralen Nordindien. Diese Gebiete sind wirtschaftlich rückständig, doch bergen sie reiche Naturschätze, etwa Bauxit, die große Firmen in Verbindung mit der Regierung abbauen wollen. Das bedeutete die Zerstörung ganzer Landstriche mitsamt ihrer Besiedlungsstruktur. Die Guerrilla nannte sich früher "Naxaliten", heute "Maoisten". In der Mehrzahl handelt es sich um Angehörige der Ureinwohner. Sie nehmen immer größere Gebiete ein, auch in Südindien und Westbengalen, und treffen auf die harte Hand der Sicherheitskräfte und der von Politikern organisierten Privatarmeen, die morden, brandschatzen, plündern und vergewaltigen.
Als eine der wenigen Außenseiterinnen wurde Arundhati Roy von den Maoisten eingeladen, sie auf den Streifzügen durch "ihre" Wälder zu begleiten. Nun beschreibt sie ihre Gespräche mit führenden Kadern, in denen die Geschichte der Bewegungen aufscheint. Diese begannen 1950, als der Staat die Stämme per Gesetz ihres traditionellen Besitzes, der Wälder, beraubte und unterschiedliche Interessengruppen die Wälder zu nutzen begannen. Sie schildert das Schicksal zahlreicher junger Frauen, das sie zu Kämpferinnen werden ließ. Eine Romantisierung kann Roy dabei nicht ganz vermeiden; das Wort "schön" kommt nirgendwo sonst in ihrem Werk so häufig vor. Doch gelingt es ihr, die Maoisten differenziert zu beschreiben und so der Dämonisierung durch die Medien entgegenzuwirken. Nur gelegentlich findet die Überlegung Eingang, dass der maoistische Weg keine gerechte Lösung sein kann, weil er sich in Gegenmord und Gegenzerstörung erfüllt. Auch die archaische Organisation der Dörfer, die eine Art Parallelverwaltung aufgebaut haben, kann nur im Untergrund lebensfähig bleiben. Hilflos fragt die Schriftstellerin: "Gibt es eine Alternative?" Nur wenige Tage nach Erscheinen ihres Aufsatzes geschah das bisher größte Massaker in der Geschichte der maoistischen Bewegung. 76 Angehörige der Sicherheitskräfte wurden getötet; die Politiker schworen wieder einmal, die Guerrilla aufzureiben. Seitdem hat Arundhati Roy von vielen Podien des Landes gesprochen, um die herrschende Klasse zu einem Dialog aufzurufen. Arundhati Roy hat einen neuen Feldzug begonnen. Wird sie je zu ihrem zweiten Roman kommen?
MARTIN KÄMPCHEN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Bei den maoistischen Partisanen: Arundhati Roy zwischen Romantik und Realismus
SANTINIKETAN, 9. Mai
Seit Jahren geht das Gerücht, Arundhati Roy schreibe an einem zweiten Roman. Doch hat die Autorin seit dem phänomenalen Erfolg des 1997 erschienenen "Der Gott der kleinen Dinge" ausschließlich Essays und Reden verfasst, die sie als Aktivistin für die Interessen der Stammesangehörigen in Zentralindien, gegen Big Business und die multinationalen Konzerne, gegen den wirtschaftlichen Imperialismus der Vereinigten Staaten ausweisen. Jahrelang kämpfte sie mit der Feder gegen die großen Staudämme im Narmada-Tal. Man musste allerdings häufig bezweifeln, dass ihre Schlussfolgerungen stimmten, denn sie bereitete Fakten und Zahlen lieber suggestiv als wissenschaftlich auf. So traute Roy sich Urteile über weltpolitische Zusammenhänge zu, wobei man den Eindruck unzulässiger Vereinfachung nie ganz abschütteln konnte.
Nun hat Arundhati Roy einen langen Essay vorgelegt, eigentlich einen Reisebericht, der konkret und persönlich bleibt und darum nach dem Roman ihr überzeugendster Prosatext ist. Er beschreibt eine Reise ins dunkle Herz Indiens, in die von Partisanen besetzten Wälder und Höhenzüge im zentralen Nordindien. Diese Gebiete sind wirtschaftlich rückständig, doch bergen sie reiche Naturschätze, etwa Bauxit, die große Firmen in Verbindung mit der Regierung abbauen wollen. Das bedeutete die Zerstörung ganzer Landstriche mitsamt ihrer Besiedlungsstruktur. Die Guerrilla nannte sich früher "Naxaliten", heute "Maoisten". In der Mehrzahl handelt es sich um Angehörige der Ureinwohner. Sie nehmen immer größere Gebiete ein, auch in Südindien und Westbengalen, und treffen auf die harte Hand der Sicherheitskräfte und der von Politikern organisierten Privatarmeen, die morden, brandschatzen, plündern und vergewaltigen.
Als eine der wenigen Außenseiterinnen wurde Arundhati Roy von den Maoisten eingeladen, sie auf den Streifzügen durch "ihre" Wälder zu begleiten. Nun beschreibt sie ihre Gespräche mit führenden Kadern, in denen die Geschichte der Bewegungen aufscheint. Diese begannen 1950, als der Staat die Stämme per Gesetz ihres traditionellen Besitzes, der Wälder, beraubte und unterschiedliche Interessengruppen die Wälder zu nutzen begannen. Sie schildert das Schicksal zahlreicher junger Frauen, das sie zu Kämpferinnen werden ließ. Eine Romantisierung kann Roy dabei nicht ganz vermeiden; das Wort "schön" kommt nirgendwo sonst in ihrem Werk so häufig vor. Doch gelingt es ihr, die Maoisten differenziert zu beschreiben und so der Dämonisierung durch die Medien entgegenzuwirken. Nur gelegentlich findet die Überlegung Eingang, dass der maoistische Weg keine gerechte Lösung sein kann, weil er sich in Gegenmord und Gegenzerstörung erfüllt. Auch die archaische Organisation der Dörfer, die eine Art Parallelverwaltung aufgebaut haben, kann nur im Untergrund lebensfähig bleiben. Hilflos fragt die Schriftstellerin: "Gibt es eine Alternative?" Nur wenige Tage nach Erscheinen ihres Aufsatzes geschah das bisher größte Massaker in der Geschichte der maoistischen Bewegung. 76 Angehörige der Sicherheitskräfte wurden getötet; die Politiker schworen wieder einmal, die Guerrilla aufzureiben. Seitdem hat Arundhati Roy von vielen Podien des Landes gesprochen, um die herrschende Klasse zu einem Dialog aufzurufen. Arundhati Roy hat einen neuen Feldzug begonnen. Wird sie je zu ihrem zweiten Roman kommen?
MARTIN KÄMPCHEN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main