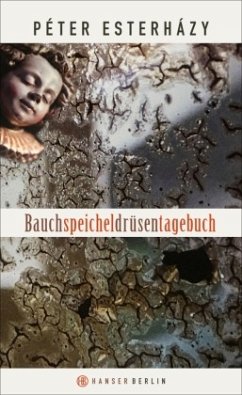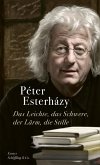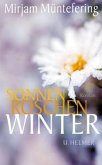Péter Esterházys letztes Buch. Es ist das Tagebuch seiner Krankheit, in dem er seiner Erkrankung begegnet, wie er Gott und der Welt und dem Leben immer begegnet ist: aufrichtig und neugierig, spielend, voll Geist und Witz und Liebe zum Leben. Und mit dem Stift in der Hand: schreibend. Doch was ist, wenn sich der eigene Körper auf einmal gegen das Schreiben wendet? Wie hält der Schriftsteller, dessen Werk auf die Unentwirrbarkeit von Wirklichkeit und Dichtung aufbaut, seine Tage fest? Was passiert mit der "ontologischen Heiterkeit", wenn die tödliche Krankheit zur täglichen Übung wird? Kann der Bauchspeicheldrüsenkrebs als Liebesgeschichte beschrieben werden? Keine einfache Geschichte.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.