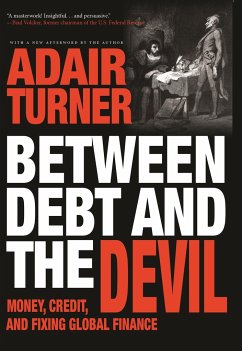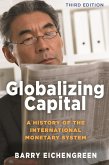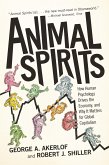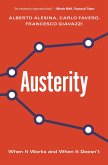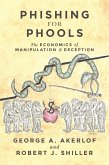Adair Turner became chairman of Britain's Financial Services Authority just as the global financial crisis struck in 2008, and he played a leading role in redesigning global financial regulation. In this eye-opening book, he sets the record straight about what really caused the crisis. It didn't happen because banks are too big to fail--our addicti
"Turner offers a convincing account of the debt-fuelled global economic cycle of the last 15 years or so. I found myself skimming over large sections and nodding in agreement."--Erik Britton, Management Today
"[Between Debt and the Devil] represents an important challenge to economic orthodoxy, which, as [Turner] rightly notes, has already failed us once."---John Cassidy, New Yorker