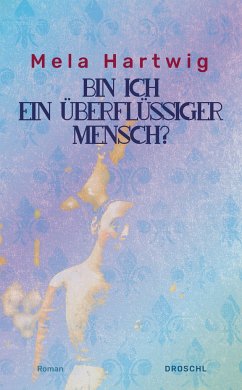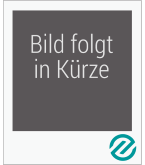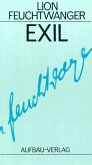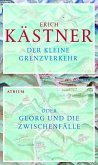Wie in ihren früheren Werken stellt Mela Hartwig in ihrem zweiten Roman eine Frau in den Mittelpunkt, die mit sich uneins ist, eine "Neurotikerin", die mit jedem Schritt an die ihr auferlegten Begrenzungen stößt: eine unscheinbare und sehr entbehrliche Sekretärin ohne besondere Fähigkeiten, die eines Tages einer erotischen Obsession verfällt. Ein im Gestus des schonungslosen Geständnisses formulierter Roman einer unerhörten Selbsterniedrigung, präzise in der messerscharf geschilderten sozialen Situation der frühen 30er Jahre lokalisiert, und in einer Sprache, die den expressionistischen Gestus der früheren Texte zugunsten eines dokumentarisch-nüchternen Stils aufgegeben hat.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno