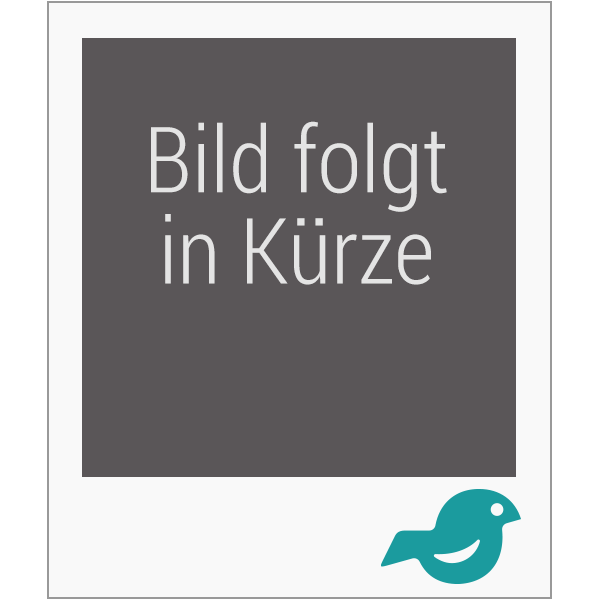Ted Hughes's "Birthday Letters" are addressed, with just two exceptions, to Sylvia Plath, the American poet to whom he was married. They were written over a period of more than twenty-five years, the first a few years after her suicide in 1963. Intimate and candid in manner, they are largely concerned with the psychological drama that led both to the writing of her greatest poems and to her death. Countless books have discussed the subject from a neccescary distance, but this is the first time that Ted Hughes has given his personal account.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno