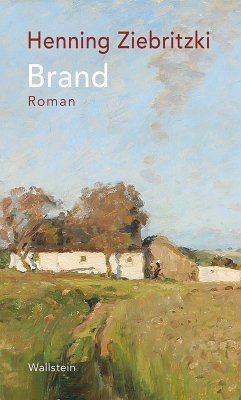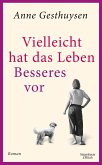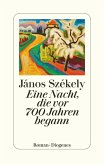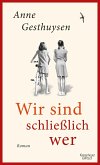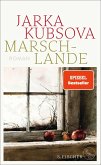Dieser Debütroman erkundet die Kindheit eines aufmerksamen Jungen zwischen rauem Dorfalltag, vom Krieg geprägten Erwachsenen und ersten poetischen Eindrücken.In den Erinnerungen eines im Dorf Brand aufgewachsenen Jungen werden Familie und Einwohner ebenso lebendig wie der Hintergrund der Zeitgeschichte und der norddeutschen Landschaft. Es sind die sechziger Jahre, von den Erwachsenen nur »die Zeit nach dem Krieg« genannt. Die Begegnung mit dem komischen August, der eine Art Dorftrottel ist, die erste erotische Empfindung, ausgelöst durch die Lehrerin auf dem Schulhof, die Urgroßmutter und der tote Großvater prägen das Kind ebenso wie das Spektakel des Schweineritts, die bedrohliche Begegnung mit einem Fremden auf dem Erntefest, Erfahrungen mit dem Übersinnlichen beim Milchholen und die erste Lektüre eines Gedichtes von Goethe. Eine besondere Rolle spielen die Erzählungen der Mutter vom Dorf und seinen Bewohnern, die den Jungen nachhaltig beeinflussen und zu seinen ersten poetischen Erlebnissen werden. Henning Ziebritzki schildert in anschaulicher und poetischer Sprache eindrückliche Szenen einer Kindheit auf dem Land.
»Wie der namenlose Ich-Erzähler in der Rückschau von seiner Kindheit im Dorf Brand erzählt, zeugt von ungeheurem Formbewusstsein, das indes nie angestrengt, geschweige denn prätentiös wirkt, im Gegenteil: es ist eine Sprache, die mit ihrem Inhalt zusammenfällt, es ist eine glasklare, schlendernde Sprache, die das Schauen und Staunen sinnlich nachempfindbar macht.« (Christiane Pöhlmann, FAZ, 22.03.2025) »Es ist ein schmaler Band mit viel Gewicht, sowohl inhaltlich als auch sprachlich.« (Gerhard Keck, Südwest Presse, 11.09.2025)