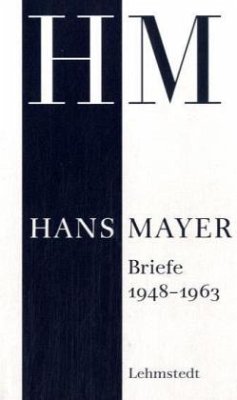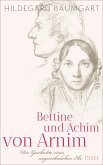Hans Mayers Briefe aus den Jahren 1948 bis 1963, in denen er an der Leipziger Universität gewirkt hat, sind ein umfassendes Spiegelbild der geistig-kulturellen Entwicklung der frühen DDR mit all ihren Höhen und Tiefen. Ob Thomas Mann oder Hermann Hesse, Bertolt Brecht oder Johannes R. Becher, Peter Huchel oder Franz Fühmann, Hans Werner Richter oder Günter Grass - Hans Mayer korrespondierte mit allen. Die Briefe machen deutlich, daß Mayer sich stets als Mittler verstand: Mittler zwischen Büchern und Lesern, Mittler zwischen Literatur und Wissenschaft, Mittler vor allem zwischen Ost und West - trotz Kaltem Krieg und persönlichen Anfeindungen von beiden Seiten.

Der hat im Kopf mehr als andere im Laptop: Hans Mayers Briefe
Damals in Leipzig, Anfang der fünfziger Jahre, hatte es sich unter uns Studenten herumgesprochen, dass ein Neuer da sei, ein noch ziemlich junger Professor, der gerade aus dem Exil zurückgekehrt war und zu dem es sich lohne hinzugehen. Er spreche atemlos, über die Satzenden hinweg, wisse unendlich viel, zeige das allerdings auch, aber sei eben ganz einfach interessant. Dass er drüben in der Gewifa las, der Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät, war zwar ein Handicap, denn das war üblicherweise das Reservat der Genossen. Aber was dieser Hans Mayer über das neunzehnte Jahrhundert, über Heine und Büchner vorzutragen hatte, klang so ganz anders als das, was wir sonst dort oder bei den Germanisten zu hören bekamen.
Gewiss schien er mit Marx auf gutem Fuße zu stehen; aber das große Panorama von Namen und Tendenzen eines Jahrhunderts, das er vor uns entfaltete, war faszinierend und lag weit jenseits allen offiziellen Kanons, des neuen, angeblich sozialistischen, wie des alten geisteswissenschaftlichen. Sprachgrenzen wurden aufgehoben, neben die Deutschen traten Balzac, Flaubert, Dickens. Und die Perspektiven wurden noch weiter durch die Musik, von der Mayer eine Menge zu verstehen schien, von Berlioz und Mendelssohn zum Beispiel und vor allem von Wagner. Hier, das wurde deutlich, spielte jemand auf einer großen Orgel mit allen Registern: Hans Mayer, geboren zu Köln am 19. März 1907.
Eines der Register, das Mayer gern zog, führte aus der Geschichte in die Gegenwart. Floskeln, leichthin eingestreut, wie "Brecht sagte mir neulich", verwendbar auch für Namen wie "Frau Seghers" oder "Doktor Becher", verfehlten ihre Wirkung bei jungen, bewunderungsbereiten Studenten nicht. Offenbar ging dieser Mayer bei der kulturellen Prominenz des eben erst gegründeten Staates ein und aus. War das alles staunenerregend, so war etwas anderes achtunggebietend. Mayer hatte gerade ein Buch über Thomas Mann geschrieben, dessen Werk in Leipzig zwar unerreichbar war, der aber 1949 zu Goethes Ehren als gefeierter Staatsbesucher durch die Republik geführt worden war. Ihn selbst also, den Großen, hatte er in der Schweiz besucht, wobei für uns, abgesehen vom Transfer des Hauches von Größe durch den Zwischenträger Hans Mayer, mindestens ebenso aufregend war, dass man tatsächlich in diese Schweiz reisen konnte, vorausgesetzt, dass man durfte.
Und Mayer durfte. Er würde demnächst, ließ er uns wissen, Vorlesungen halten in München, Tübingen, Zürich, Paris und anderswo in dieser Traumlandschaft des Westens. Verkündet wurden solche Reisepläne gern am Ende der Vorlesung im Pluralis Majestatis: "Wir werden demnächst in Heidelberg (oder Stuttgart oder Rom) über Goethe (oder Lessing oder Kleist oder Brecht oder Thomas Mann) lesen" - eine seltsame Allüre, die offenbar dem Gesprochenen die Würde des Gedruckten geben sollte, wie es sich ja in der Wissenschaft auf lange Zeit nicht gehörte, "ich" zu sagen. Auch das "lesen", wie Mayer es brauchte, stammte wohl daher, denn eigentlich las er ja nicht, sondern sprach frei und hatte in seinem wunderbaren Gedächtnis mehr parat als andere heute in ihrem Laptop.
Was wir nicht wussten und uns damals vielleicht auch nicht gekümmert hätte: Mayer, der hier so souverän im Plural von sich sprach, war allein und war es auf eine viel profundere Weise, als wir uns das wohl hätten vorstellen können. Fünf Jahre hat Hans Mayer, wie er mir einmal schrieb, an seinem Buch über "Außenseiter" gearbeitet, einem Meisterstück mayerscher Brillanz, immer überraschend im gewaltigen Fundus des Wissens und klar, geschliffen in seiner Sprache. Es ist wohl sein persönlichstes Buch geworden, auch wenn es sich nach außen als Kulturgeschichte gibt und so lesen lässt. Die "Außenseiter": Das sind für Mayer die Juden und Homosexuellen - er war beides -, und es sind für ihn auch die Frauen in einer Männergesellschaft, mit denen er sich freundschaftsfähig solidarisch empfand, denn er war kein Frauenfeind und konnte ein charmanter Gesellschafter sein. Aber sein Außenseitertum war noch breiter angelegt. Mayer kam aus einem wohlhabenden Elternhaus, nur dass der Vater als überzeugter Sozialdemokrat aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrte. Das wiederum ebnete dem Sohn den Zugang zum Marxismus und zur Arbeiterbewegung, für die er in der Tat tätig wurde. Für die bürgerliche Welt, der er als angehender Jurist zustrebte, stellten indes gerade solche Sympathien einen weiteren Schritt ins Außenseitertum dar. Das letzte Kriterium dafür aber war doch wohl Mayers scharfe, glänzende, außerordentliche Intelligenz, denn nichts isoliert so sehr wie sie und wird immer wieder und zu allen Zeiten neben der Bewunderung das stille oder laute Misstrauen der anderen provozieren.
Wirklich ein Außenseiter wird man allerdings erst, wenn man keiner sein möchte. "Ein Deutscher auf Widerruf" lautet der Titel der zwei Bände von Mayers Lebenserinnerungen. Aber er war zugleich auch ein Deutscher im Widerspruch - mit sich selbst wie mit der Gesellschaft, die ihn feindlich oder freundlich umgab. Denn eigentlich wollte er ja dazugehören, wo er sich von Gleichgesinnten umgeben sah, hatte Lust an der Geselligkeit und schloss sich dann doch wieder durch die unhemmbare Demonstration seiner Überlegenheit, durch geradezu monumentale, atemberaubende Akte der Eitelkeit oder, wie er selbst zugestand, durch gelegentliche Wutausbrüche davon aus. Er konnte - man muss es erlebt haben! - eine fremde Universitätsbibliothek mit seinen Gastgebern betreten, unverzüglich auf den Katalog zusteuern und ohne jede vornehme Zurückhaltung strengstens prüfen, ob denn auch wirklich alle seine Werke vorhanden waren. Und wehe, wenn da auch nur eines fehlte. Andere indes tun das auch, nur verhohlener; aber ebendies, dass er seine Schwächen so offen und schutzlos zutage trug, machte ihn auch wieder liebenswert und schließlich zum freundlichsten Gast der Welt, der - was von manchen bestritten wird, was ich aber gern bestätige - durchaus still zuhören konnte.
Seit kurzem gibt es nun noch ein weiteres, wenngleich nicht mehr autorisiertes Buch von Hans Mayer, der 2001 starb. Es ist ein Buch, das seine ganze innere Spannung zwischen Außenseitertum und Dazugehörenwollen zugleich als ein Stück deutscher Geschichte darbietet: eine Edition seiner Briefe aus der Zeit der Leipziger Professur. 1948 war er dorthin berufen worden; am 17. August 1963, zwei Jahre nach der Errichtung der Berliner Mauer, erklärte er von Hamburg aus seinen Entschluss, nicht mehr in die DDR zurückzukehren. Das Buch lässt sich auf verschiedene Weise lesen: als Material zur äußeren Biographie, als eine Dokumentation der Sehnsucht nach der Überwindung seines Außenseitertums, aber auch als eine Dokumentation der ganzen geistigen Hoffnungslosigkeit des Arbeiter-und-Bauern-Staats. Es ist ein Buch über verlorene Illusionen und über den Triumph politischer Dummheit und Engstirnigkeit über einen bedeutenden deutschen Intellektuellen.
Man wird in diesen Briefen nicht in erster Linie nach Erkenntnissen über Literatur, Geschichte und Politik suchen dürfen oder gar Intimitäten über das Privatleben ihres Verfassers erwarten. Davon enthalten sie überraschend wenig. Eher sind sie Dokumente einer großen Einsamkeit, die sich - eine andere Art von Eitelkeit - darin äußert, dass er, wie einst uns als Studenten, allen möglichen Leuten mitteilt, was alles er gerade tut, wohin er reist, wer ihn eingeladen hat. Wirklich Persönliches, also Gefühle und Geschmacksurteile, findet sich lediglich in Briefen an den jungen Juristen Walter Wilhelm. Und das klingt dann so: Oben - es ist die Tschaikowskistraße in Leipzig, Mayers Wohnung während seiner gesamten Zeit dort - übt jemand "die ,Kinderszenen'. Seltsam, wenn man sie so gestümpert hört, kann man plötzlich Hans von Bülows böses Wort über Schumanns ,Intervallenheulerei' verstehen! Früher war ich in allen Schumanndingen unersättlich; längst nicht mehr . . ." Die Laufbahn als Konzertpianist hatte er selbst einst ins Auge gefasst, aber die Finger waren zu kurz. Und am Schluss erst folgt dann werbend ("So, nun bist Du wieder an der Reihe") und scheu, Gemeinsamkeit suchend, die Bitte um "einen vernünftigen & herzlichen Brief: weder Stilübung, noch ungedrucktes Feuilleton". Gespreiztheit hat ihm nie gelegen.
Mayer kam nach Leipzig mit Enthusiasmus und dem besten Willen dazuzugehören, aber auch in dem Gefühl, dass er dort zu Hause sei, wo neben Marx und Engels auch Goethe und Schiller als Klassiker galten. Das stellte sich rasch als Täuschung heraus; zunächst, als man ihn im Lande hin und her schieben wollte: "Es besteht ein Missverhältnis zwischen dem, was ich im Rahmen meiner Kräfte zu leisten suche und doch wohl auch leiste - und der Behandlung, die mir die amtlichen Stellen zuteil werden lassen." So bereits 1950 an Bildungsminister Paul Wandel.
Bald danach ging es an die Substanz, so bei der Frage, ob eine "mehr oder weniger subalterne Kommission" durchsetzen könne, das lyrische Werk Georg Kaisers oder Gottfried Benns der deutschen Öffentlichkeit vorzuenthalten. In Benns Sog, so schreibt er im September 1961, also nach dem Mauerbau, an Friedrich Wilhelm Oelze, sei er erst spät geraten, aber dann immer mehr. Und darauf folgen die hellsichtigen Sätze: "Das ist romantische Nachfolge, was immer Benn denken mochte. Der Geigenton Storms übertragen auf das Cello, gelegentlich gestört, oder eigentlich auch kontrapunktisch bereichert, durch Jazz-Einlagen." Das Werk Benns war, was heute leicht vergessen wird, bis in die achtziger Jahre in der DDR tabu, also unerreichbar und unerwünscht.
Mayer hatte bei alledem viele Privilegien. Er durfte in den "Westen" reisen, von dort Bücher mitbringen oder sie sich schicken lassen. Nicht nur für sich hat Mayer die Grenze weitgehend zu ignorieren versucht, sondern auch zum Vorteil seiner Studenten. Das zeigen in diesen Briefen die Einladungen an die damaligen Größen westdeutscher Germanistik, an Wilhelm Emrich, Friedrich Beißner, Erich Trunz und Fritz Martini, und ebenso die an Herman Meyer in Amsterdam und Eudo Mason in Edinburgh. Es waren eben nicht nur kaschierte Selbsteinladungen, es war auch ein Beispiel privater Deutschland-Politik, wobei - das sei ausdrücklich hinzugefügt - Mayer seinen westdeutschen Kollegen gegenüber keinen Zweifel daran ließ, dass ihm die Rolle einiger ehemaliger brauner Parteigenossen in Adenauers Staat durchaus nicht gefiel. Aber sie waren eben nicht füreinander geschaffen, diese DDR und dieser Professor. 1956 begann seine Überwachung durch die SED-Kulturfunktionäre, erst subtil, später in "Totschlägermanier".
Den Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze. Auch den Literaturprofessoren nicht, obwohl sie es wahrscheinlich nicht alle einsehen möchten. Hans Mayer aber kann zufrieden sein. Das Denkmal, das ihm diese reiche, gut annotierte Briefausgabe setzt, zeigt, dass noch viel zu lernen ist von ihm über deutsche Zeitgeschichte, über den Umgang des Staates mit seinen Intellektuellen, über Außenseiter, von denen immer wieder neue kommen werden, und natürlich vor allem über "die heil'ge deutsche Kunst", wie Hans Sachs in den "Meistersängern" jene Sache nennt, der Hans Mayer sein Leben verschrieb.
GERHARD SCHULZ.
Hans Mayer: "Briefe 1948-1968". Herausgegeben und kommentiert von Mark Lehmstedt. Lehmstedt Verlag, Leipzig 2006. 630 S. geb. , 29,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Der jetzt veröffentlichte Briefband von Hans Mayer bietet im Grunde nichts, was nicht schon aus seinen Erinnerungen bekannt ist, und er lässt auch keinen Blick in das Privatleben des Literaturwissenschaftlers zu, stellt Heinz Schlaffer enttäuscht fest. Die Briefe, die er mit so bekannten Autoren wie Bertolt Brecht oder Max Frisch tauschte, sind fast ausschließlich Geschäftskorrespondenz, in der es um Terminabsprachen oder die Organisation von Vorträgen und Ähnlichem ging. Zwar könne man viel über die spezifischen Bedingungen der Literaturwissenschaft und Kritik in der DDR lesen und Mayers Auseinandersetzung damit, konzediert der Rezensent, den es aber dennoch wundert, dass Mayer so gar nichts über sein Innenleben preisgibt. Selbst die Korrespondenz mit dem engen Freund Walter Wilhelm bleibt vergleichsweise zurückhaltend. Dafür hat Mayer aber keine Gelegenheit ausgelassen, in seinen Briefen auf seine beruflichen Erfolge hinzuweisen, ein "Geltungsbedürfnis", das der Rezensent allerdings als Überlebensstrategie eines Querdenkers in der DDR verteidigt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH