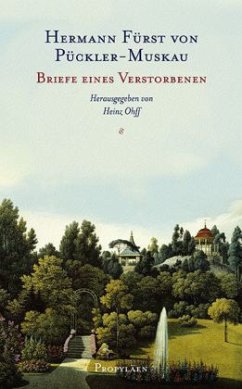'Hermann Fürst von Pückler-Muskau, Exzentriker, Lebemann und Gartengestalter, war zugleich ein Schriftsteller von hoher stilistischer Eleganz.
Witzig und geistvoll berichtete er seiner Frau Lucie in langen Briefen von seiner berühmten Englandreise 1826 bis 1829. Die Erstausgabe aus dem Jahre 1830, herausgegeben von Varnhagen von Ense, lobte Goethe überschwenglich als ein "für Deutschlands Literatur bedeutendes Werk". Dieses schönste deutsche Reisebuch, vergleichbar nur Heines "Reisebildern", erscheint hier vollständig und zum ersten Mal mit einem sorgfältigen kulturhistorischen Kommentar versehen.
Witzig und geistvoll berichtete er seiner Frau Lucie in langen Briefen von seiner berühmten Englandreise 1826 bis 1829. Die Erstausgabe aus dem Jahre 1830, herausgegeben von Varnhagen von Ense, lobte Goethe überschwenglich als ein "für Deutschlands Literatur bedeutendes Werk". Dieses schönste deutsche Reisebuch, vergleichbar nur Heines "Reisebildern", erscheint hier vollständig und zum ersten Mal mit einem sorgfältigen kulturhistorischen Kommentar versehen.

Tieftauchen im Regency: Fürst Pücklers "Briefe eines Verstorbenen"
"Übrigens las George IV. ungeachtet seiner Schwäche mit vielem Anstande und schönem Organ, aber auch mit königlicher Nonchalance, die nicht viel danach fragt, ob die Majestät sich verspricht oder ein Wort nicht gleich dechiffrieren kann, die banale Rede ab. Man sah indes deutlich, dass der Monarch erfreut war, als die corvée (Fron) ihr Ende erreicht hatte, so dass der Abgang auch etwas rüstiger vonstatten ging als der Einzug." Der England-Tourist, der hier etwas respektlos seine Eindrücke im House of Lords wiedergibt, existiert im Bewusstsein seiner Nachwelt vornehmlich als unfreiwilliger Namengeber einer Speiseeistrilogie sowie als Parkkünstler.
Seinerzeit war Hermann Fürst von Pückler-Muskau auch als Sonderling und Reiseschriftsteller berühmt. Seine "Briefe eines Verstorbenen", die er zwischen 1826 und 1829 von den Britischen Inseln sandte, avancierten zum internationalen Bestseller. Noch heute sollten sie Pflichtlektüre zumindest für anglophile Literaturfreunde sein. Einen geistvolleren, rasenderen Reisereporter werden sie schwerlich finden. Der adelige Lausitzer jagt von Ball zu Ball, von Dinner zu Dinner, von den höchsten Kirchturmspitzen zu den herrlichsten Landsitzen. Sogar Bauarbeiten am Grund der Themse nimmt er mit einer Taucherglocke in Augenschein. Zwischendurch disputiert der Reisende Fragen des Handels oder der Eigenheimfinanzierung in London ebenso verständig wie die neuesten Shakespeare-Inszenierungen oder die "abgeschmackten" religiösen Konflikte in Irland. Ihm gelingt ein unübertroffen farbiges Porträt des späten Regency. Es zeigt eine Phase des Turbokapitalismus, in der die Aristokratie dem Aufstieg des Bürgertums mit unerschütterlichem Dünkel trotzte, aber bereits ulkig geworden war. Zugleich hält er seinem rückständigen Vaterland den Spiegel vor.
Goethe bezeichnete die "Briefe eines Verstorbenen" in einer halb aufrichtigen Gefälligkeitsrezension als "ein für Deutschlands Literatur bedeutendes Werk". Im Tagebuch dagegen protokolliert er seine Irritation über Pücklers "freisinnige Äußerungen, die besonders gegen die Frömmler gerichtet zu sein scheinen". Der "letzte Ritter der alten Geburtsaristokratie", wie Heine seinen hochgeborenen Freund nennt, plädiert für Parlamentarismus und Pressefreiheit, fühlt mit Fabrikarbeitern, Dienern und Prostituierten - schätzt allerdings auch den Service der letztgenannten Gruppen. Die ersten zwei von vier Teilen der provokanten Briefe erschienen im Revolutionsjahr 1830. War es eine Schrulle oder politische Rücksichtnahme, dass der Verfasser lediglich als Herausgeber auftrat und die Autorschaft einem verstorbenen Anonymus zuschob?
Die meisten Leser jedenfalls dürften über die Urheberschaft nicht im Zweifel gewesen sein. Umso mehr ergötzt der hinreißende Irrsinn des Vorworts der zwei Jahre später veröffentlichten Folgebände: Pückler zitiert in einer grotesken Séance den toten Briefsteller herbei und trägt ihm das Goethe-Lob vor. Geschmeichelt staunt der Geist, "wie der achtzigjährige Greis so jugendlich frisch noch in jeden mutwilligen Scherz des Weltkindes so teilnehmend freundlich einzugehen vermag und wie hoch er dabei dennoch in seiner Dichter-Glorie oben über uns schwebt". Kein Wunder, dass Goethe die weiteren Briefe nicht öffentlich kommentiert - zumal der adelige Nachwuchsautor hier einen Besuch bei seinem literarischen Gönner sehr ironisch ausmalt.
Das eigentliche Skandalon freilich steht nur in den unpublizierten Passagen des Reiseberichts: Der verschuldete Standesherr hatte sich von seiner Gattin Lucie, geborene von Hardenberg, pro forma scheiden lassen, um in England eine reiche Braut zu angeln und ein unbeschwertes Leben zu dritt zu führen (F.A.Z. vom 4. Juli 2006). Über den Fortgang des frivolen Unternehmens hielt er die Exfrau - sie ist die Adressatin der Korrespondenz - detailliert auf dem Laufenden. Es endete kläglich, weil Londons Klatschpresse den Plan ausposaunte und Pückler zur gesellschaftlichen Witzfigur geriet. Manche Kritik an den versnobten Briten ist vor diesem Hintergrund zu lesen.
Übrigens ist die Sprache des Aristokraten Grund genug, sich seinen Briefen zu widmen. Wo finden wir heute so schöne Wörter wie "fatigant" (lästig), "hidös" (abscheulich), "lugubre" (kläglich) oder "Occiput" (Hinterkopf)? Schade ist bloß, dass der Verlag uns einen tausendseitigen Wälzer ohne gesammelte Inhaltsangaben zumutet. Die zweibändige DDR-Ausgabe bei Rütten und Loening von 1987 ist praktischer und schöner. Doch sei dem im Februar verstorbenen Pückler-Experten Heinz Ohff Dank, dass er das vergriffene Werk neu herausgegeben hat.
FELIX JOHANNES KRÖMER.
Hermann Fürst von Pückler-Muskau: "Briefe eines Verstorbenen". Herausgegeben von Heinz Ohff. Propyläen Verlag, München 2006. 1008 S., geb., 29,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Dass der Name Pückler mehr bedeutet als eine "Speiseeistrilogie" macht Felix Johannes Krömer klar. Die dereinst bestsellenden Briefe des rasenden Fürsten liest er als "farbiges Porträt des späten Regency", als "geistvolle" Reisereportagen über Fragen des Handels oder die neuesten Shakespeare-Inszenierungen. Vor einem, der wie Pückler um 1825 Pressefreiheit und Parlamentarismus fordert, zieht Krömer den Hut, erst recht, wenn er sich dabei so schöner Wörter bedient, wie "hidös", um seinen Abscheu auszudrücken, oder "Occiput" für Hinterkopf. Dem Verlag indessen rät Krömer, sich an der alten DDR-Ausgabe der Briefe ein Beispiel zu nehmen. Sie verfügt über die hier vermisste Inhaltsangabe, ist "praktischer und schöner".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH