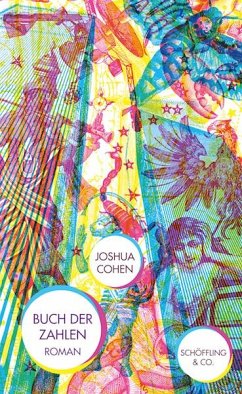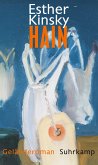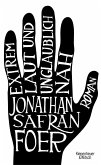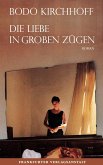All seine Erwartungen und Hoffnungen stürzen mit den Türmen des World Trade Centers in sich zusammen. Sein neues Buch ist einfach uninteressant ob der Entwicklungen und seine Frau hat sich auch endgültig von ihm verabschiedet. Joshua Cohen ist am Tiefpunkt seiner Karriere und seines Privatlebens
angekommen. Dass zeitgleich alte Freunde so richtig durchstarten, macht es auch nicht besser. Ein…mehrAll seine Erwartungen und Hoffnungen stürzen mit den Türmen des World Trade Centers in sich zusammen. Sein neues Buch ist einfach uninteressant ob der Entwicklungen und seine Frau hat sich auch endgültig von ihm verabschiedet. Joshua Cohen ist am Tiefpunkt seiner Karriere und seines Privatlebens angekommen. Dass zeitgleich alte Freunde so richtig durchstarten, macht es auch nicht besser. Ein unerwarteter Auftrag scheint die Rettung zu sein: sein Namensvetter und Gründer von „Tetration“ engagiert ihn als Ghostwriter, um seine Autobiographie zu verfassen. Während die beiden um die Welt jetten, erzählt der Millionär in zahlreichen Interviews von seinem Aufstieg vom kleinen Mathematikstudenten zum Herrscher über das Internet.
Joshua Cohen zählt unbestritten zu einer der wichtigsten jungen Stimmen Amerikas. In seinem „Buch der Zahlen“ hat er sich für ein gewagtes Konstrukt entschieden, das sicherlich für nicht wenige Leser eine Herausforderung stellen wird. Schaut man jedoch unter die Oberfläche der Erzählung, finden sich zahlreiche interessante und kritische Momente, bisweilen sogar geradezu zynische Kommentare. In Anbetracht des Verfassungszeitraums muss man anerkennen, dass Cohen viele der Wikileaks Enthüllungen vorwegnahm und die Gefahren, die uns Nutzern erst mit den Veröffentlichungen bekannt wurden, sehr klar formulierte.
Die Figur des Firmengründers Cohen ist ohne große Schwierigkeiten als Kopf hinter dem Google Konzern zu erkennen. Die Entstehungsgeschichte der die Welt beherrschenden Suchmaschine, die aus einer Idee von Studenten entstand und sich zum gigantischen Unternehmen entwickelte, nimmt den Hauptteil der Handlung ein. Immer wieder unterbrechen Nebenhandlungen, Einwürfe und Kommentare den Erzählfluss, was eine mehrschichtige Erzählstruktur schafft. Vor allem die technischen und mathematischen Hintergründe, die detailliert seitenweise aufgeführt werden, machen es nicht ganz einfach am Ball zu bleiben – zugegebenermaßen: ich habe weder Ahnung noch Interesse an Algorithmen und habe die ausufernden Erklärungen bisweilen nur noch überflogen.
Spannender sind die Passagen über das Internet und wie die Nutzer es zum einen durch ihr Verhalten formten, nun aber umgekehrt durch selbiges beschränkt und gelenkt werden. Und vor allem: was macht das Unternehmen mit den Informationen, die es von den Nutzern erhält? Gibt es moralische Verpflichtungen zu hinterfragen, weshalb sie nach bestimmten Begriffen suchen? Wie einfach sich Cohen der Millionär aus der Verantwortung stiehlt, dürfte symptomatisch für viele Unternehmer dieser Branche stehen. Gleichzeitig sehen sich die Riesen einer neuen Konkurrenz ausgesetzt: jeder private Blog kann frei alles veröffentlichen – ob es richtig ist oder nicht. Das Phänomen der „Fake News“ wird hier schon lange vor seiner globalen Popularität thematisiert.
Die langsame Entwicklung hin zu einem durch und durch technologisierten Leben wird im „Buch der Zahlen“ nachgezeichnet, sogar ein Vorreiter von Alexa und Cortana tauchen bereits auf. Obwohl es ein Roman ist, oder gerade weil es ein Roman ist, kann Cohen seine Kritik und Warnung geschickt platzieren. Der Titel ist hierfür ausgesprochen treffend gewählt. Die Numerologie, die den Zahlen Bedeutung zuweist, ist in ein neues Zeitalter eingetreten: die Algorithmen und Codes hinter dem Internet sind die Zahlen, die unser Wissen und unseren Glauben bestimmen. Ob dieses für die Ewigkeit sein wird, darf bezweifelt werden.