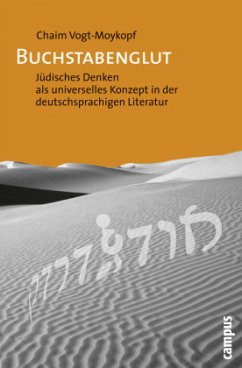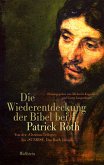In das Buch lies sich bis vor kurzem auf der Webseite des Autors Einsicht nehmen. Ein spannendes Thema. Weil wir gewohnt sind Denken zu individualisieren und vor jeder Art von Kategorisierung zu schützen. Der Autor zeigt jedoch, dass so etwas wie einen Bodensatz des jüdischen Denkens gibt, das in
ungezählten Werken von Autoren auftaucht, unabhängig davon, ob diese religiös sind oder überhaupt dem…mehrIn das Buch lies sich bis vor kurzem auf der Webseite des Autors Einsicht nehmen. Ein spannendes Thema. Weil wir gewohnt sind Denken zu individualisieren und vor jeder Art von Kategorisierung zu schützen. Der Autor zeigt jedoch, dass so etwas wie einen Bodensatz des jüdischen Denkens gibt, das in ungezählten Werken von Autoren auftaucht, unabhängig davon, ob diese religiös sind oder überhaupt dem Judentum zurechnen. Diese Grundsubstanz jüdischen Denkens zieht Vogt-Moykopf aus der Thora und aus dem Talmud und belegt sie anschaulich mithilfe von Begriffsanalysen und Wortbeispielen. So lernen wir etwa, dass viele hebräische und aramäische Wörter unzureichend oder falsch übersetzt sind und ganz andere Inhalte transportieren, als wir gewohnt sind. Das führt zu erstaunlichen Erkenntnissen. "Beten" beispielsweise heißt rückübersetzt "richten" und nicht "bitten". Vor diesem Hintergrund erschließen sich Aussagen wie Kafkas Notiz von der "Literatur als Gebet" vollkommen neu. Da sich dessen ganzes Schreiben ums Richten und Gerichtetwerden drehte (man denke nur an die Strafkolonie und an den Prozess), ist der Rückschluss auf hebräische Denktraditionen im Denken Kafkas gut nachvollziehbar. Vogt-Moykopf verlangt keine Vorkenntnisse, sondern nur aufmerksames Lesen. Der Stil ist erfrischend, bisweilen humorvoll, auf jeden Fall ein literarischer Genuss. Das ist in der deutschen Literaturwissenschaft eher eine Seltenheit. Unbedingt empfehlenswert.