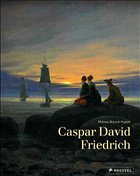Caspar David Friedrich gehört zu den bedeutendsten Malern des 19. Jahrhunderts. Seine Gemälde "Kreidefelsen auf Rügen" oder "Wanderer über dem Nebelmeer" sind zum Inbegriff des einfühlsamen Stimmungsbildes geworden und erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Helmut Börsch-Supan, einer der besten Kenner Caspar David Friedrichs, gibt in seiner Monografie einen Überblick über Leben und Werk des Künstlers, erläutert seine Hauptwerke und setzt sie in den Kontext ihrer Zeit. Der Autor vermittelt ein an den neuesten Erkenntnissen der Forschung ausgerichtetes modernes Friedrich-Bild und führt damit zu einem vertieften Verständnis seiner Kunst.

Helmut Börsch-Supan kommt Caspar David Friedrich nah
Caspar David Friedrichs Bilder erkennt man sofort. Menschenleere Landschaften und aufleuchtende Naturstimmungen hat er gemalt wie kein anderer. Friedrichs Beitrag zur Kunstgeschichte ist so eigenartig und aus seiner Zeit herausfallend, wie es für nur wenige Künstler gilt. Dieses Besondere reizt die Autoren seit langem, und so gibt es viele Monographien über den Künstler. Mal wird seine Einzigartigkeit beschwört, mal sein Werk als Teil einer Geistesströmung gesehen. Seine Gemälde gelten als Inbegriff der Romantik, und jedes Detail wird als Symbol gelesen. Dann wieder betont man das Ungewöhnliche seiner radikalen Kompositionen und sieht ihn als Vorläufer der gegenstandslosen, sinnbefreiten Malerei. Helmut Börsch-Supan beschäftigt sich seit über fünfzig Jahren mit Friedrich. Er ist der Autor des bis heute gültigen Werkverzeichnisses und zahlreicher Einzelstudien. Mit seiner Suche nach einer verborgenen christlichen Symbolik in Friedrichs Bildern gab er der Forschung in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts einen wichtigen Anstoß. Im vorliegenden Buch zieht er noch einmal Bilanz und versucht, dem Künstler nahezukommen.
Geschickt weicht Börsch-Supan den Fallen der Künstlerbiographie aus. Er leitet das Buch mit einem tabellarischen Lebenslauf ein und beginnt dann mit der Analyse eines zentralen Bildes des Spätwerks, des "Großen Geheges" in Dresden. Hier sieht er alle Details so naturalistisch aufgefasst, dass er dem Maler nachweisen kann, die Elbe scheinbar bergauf fließen zu lassen. Doch anstatt dies als Ausweis des freien Komponierens von Naturdetails zu verstehen, nimmt er das Gemalte für bare Münze und sieht in dem Schiff, das in seinen Augen auf eine Sandbank zufährt, eine Allegorie des Scheiterns. So schwer man dem Autor in dieser Wendung folgen kann, so souverän führt Börsch-Supan im Weiteren in das Bildverständnis des Malers ein. Dass er dies entgegen der Chronologie tut, ist reizvoll.
Zu Recht betont der Autor, dass die Bilder nur im Zusammenhang des Gesamtwerks verstanden werden können. Besonders geschickt demonstriert er das bei der Darstellung des Kreidefelsens auf Rügen, dessen Personal im Vordergrund zu biographischen Spekulationen Anlass gab. Börsch-Supan stellt diese Versuche vor und entzieht sich einer Festlegung, indem er das Bild in eine Reihe von psychologisierenden Selbstportraits und vor allem in eine Reihe von Freundschafts- und Abschiedsbildern stellt. Die Bedeutung einzelner Motive, die sich durch das Werk ziehen, wird anhand der Darstellung von Wegen in der Landschaft und der Jahreszeiten vorgeführt. Der abstrakte Begriff von Zeit ist ein zentrales Anliegen der Kunst Friedrichs.
Der Tod gibt Friedrichs Werk einen Grundton. Börsch-Supan verweist darauf, dass der Dreizehnjährige einen Bruder vor seinen Augen ertrinken sah und der Vierundzwanzigjährige ernsthaft versuchte, Selbstmord zu begehen. Indem der Autor die Schriften des Künstlers beim Wort nimmt, sieht er als Fundamente von Friedrichs Denken nicht nur die Gewissheit des Todes, sondern vor allem Trost, Glaube und Hoffnung auf ein ewiges Leben. Auch den Äußerungen des Künstlers über seine Zeitgenossen gibt er Gewicht und kann so die besondere Stellung, die Friedrich sich selbst zuwies, darstellen. Dabei lässt er leider die Studienzeit mit den Anregungen in Kopenhagen und Dresden zu kurz kommen. Hier rächt es sich, dass so gut wie kein Bild eines anderen Künstlers reproduziert wurde. Als Zeitgenossen treten nur die mehr oder weniger mediokren Mitläufer und Gegenspieler Friedrichs in der überwiegend vernichtenden Kritik des Malers auf.
Börsch-Supan versteigt sich nicht zu der Ansicht, die gültige Interpretation dieses Künstlers gefunden zu haben. Gerade in der Betrachtung der Einzelwerke und Selbstaussagen Friedrichs führt er den Leser an dessen Kunst heran. Nach der Lektüre hat man den Eindruck, Friedrich, den Menschen und den Künstler, besser zu kennen.
ANDREAS STROBL
Helmut Börsch-Supan: "Caspar David Friedrich". Gefühl als Gesetz. Deutscher Kunstverlag, München, Berlin 2008. 240 S., 8 Farb- u. 108 S/W-Abb., br., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main