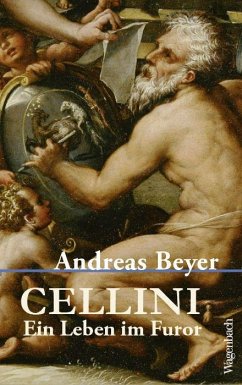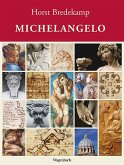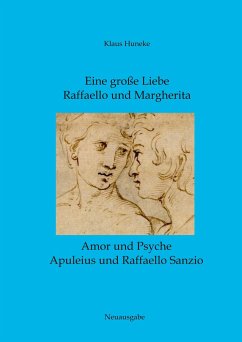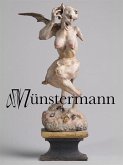Die Kunstgeschichte zeigte sich vom Leben des Benvenuto Cellini, dem überragenden Skulpteur der Renaissance, gleichermaßen fasziniert wie abgestoßen: Er war Mörder, Dieb, gewalttätiger Liebhaber aller Geschlechter, sowohl Diener als auch Herausforderer von Päpsten und Fürsten, ingeniöser Künstler.In genau diesen Rollen schildert er sich in seinem legendären Lebensbericht, der »Vita«, deren besonders verstörende Stellen in späteren Ausgaben und Übersetzungen oft ausgelassen oder abgeschwächt wurden. Sicherheitshalber hat man sein Buch zur Fiktion oder zu purer Selbststilisierung erklärt.Andreas Beyer zeigt in seiner unverschämten Neuvorstellung des Lebens und Werks Cellinis entlang der »Vita«, dass die inkriminierten Passagen über das Leibliche, Geschlechtliche und sinnliche Transgressionen nicht nur verteufelt hohen Unterhaltungswert besitzen, sondern vor allem Authentizität beanspruchen dürfen. Erst dadurch wird das Profil des daseinssüchtigen Menschen Cellini wahrhaftig sichtbar: ein Künstler, der das Leben in all seinen Möglichkeiten und Facetten mit aller Gewalt an sich riss und dabei sämtliche Grenzen der Existenz sprengte.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno