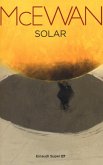Quando Eleonora e Chirú s'incontrano, lui ha diciotto anni e lei venti di più. Le loro vite sembrano non avere niente in comune. Eppure è con naturalezza che lei diventa la sua guida, e ogni esperienza che condividono dall'arte alla cucina, dai riti affettivi al gusto estetico - li rende più complici. Eleonora non è nuova a quell'insolito tipo di istruzione. Nel suo passato ci sono tre allievi, due dei quali hanno ora vite brillanti e grandi successi. Che ne sia stato del terzo, lei non lo racconta volentieri. Eleonora offre a Chirú tutto ciò che ha imparato e che sa, cercando in cambio la meraviglia del suo sguardo nuovo, l'energia di tutte le prime volte. È così che salgono a galla anche i ricordi e le scorie della sua vita, dall'infanzia all'ombra di un padre violento fino a un presente che sembra riconciliato e invece è dominato dall'ansia del controllo, proprio e altrui. Chirú, detentore di una giovinezza senza più innocenza, farà suo ogni insegnamento in modo spietato, regalando a Eleonora una lezione difficile da dimenticare.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno