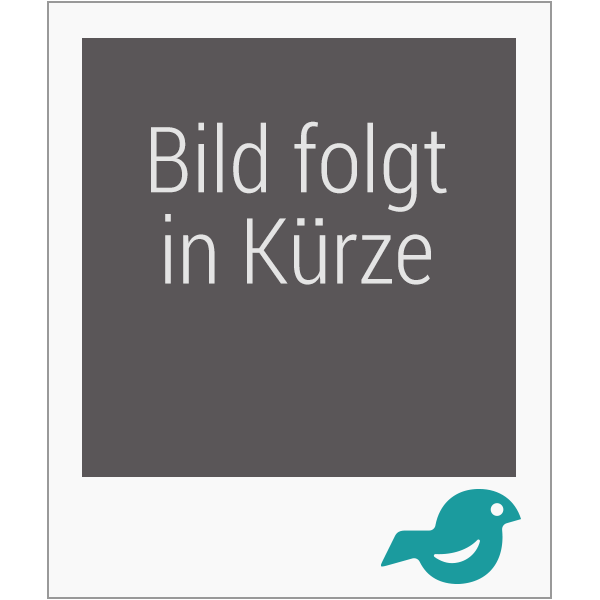Produktdetails
- Verlag: Brill Mentis
- Seitenzahl: 298
- Erscheinungstermin: 13. Januar 2009
- Deutsch
- Abmessung: 235mm
- Gewicht: 426g
- ISBN-13: 9783897855663
- ISBN-10: 3897855666
- Artikelnr.: 25027201
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Das Folterverbot gilt absolut, erklärt Florian Lamprecht. Doch so einfach, wie es manchmal aussieht, lässt sich die Unzulässigkeit der Folter in Grenzsituationen nicht begründen.
Seinen Vortrag "Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?" eröffnet Niklas Luhmann 1992 mit einem berühmt gewordenen Gedankenexperiment. Er fordert seine Zuhörer auf, sich vorzustellen, sie seien höhere Polizeioffiziere in einem von Terrorgruppen drangsalierten Land und hätten den Führer einer dieser Gruppen gefangen. "Sie könnten, wenn Sie ihn folterten, vermutlich das Leben vieler Menschen retten - zehn, hundert, tausend, wir können den Fall variieren. Würden Sie es tun?" Was er selbst tun würde, verrät Luhmann nicht. An einem lässt er hingegen keinen Zweifel: "Man kann es nur falsch machen." Wie immer man sich entscheidet, man wird sich danach für den Rest seines Lebens schämen.
Luhmanns Sinn für das Tragische dieser Situation ist den meisten der heutigen Wortführer in der Folterdiskussion fremd. Sie wissen, was richtig und was falsch ist, wer auf der Seite der Guten und wer auf jener der Bösen steht. Die Bösen, das sind die Amerikaner, die in Abu Ghraib und Guantánamo Gefangene bedroht, misshandelt und gedemütigt haben - folternde Russen, Chinesen, Araber und Kubaner kommen im deutschsprachigen Schrifttum praktisch nicht vor. Die Guten, das sind jene, die im Namen der Menschenwürde der Betroffenen gegen jedwede Lockerung des Folterverbots eintreten. Den Terroropfern wird dabei lediglich eine Randexistenz zugebilligt. Ihre etwaigen Schutzansprüche gegen den Staat, so wird versichert, könnten den Würdeanspruch der Gefolterten in keinem Fall übertrumpfen.
Dass man die Dinge so sehen kann und womöglich sogar muss, steht außer Frage. Freilich bürdet man der Menschenwürde damit eine außerordentlich große Begründungslast auf. Den allgemeinen Grundsätzen rechtlicher und moralischer Verantwortungsverteilung entspricht es, denjenigen, die für eine Gefahrenlage verantwortlich sind, also den Terrorverdächtigen, und nicht etwa den gänzlich unschuldigen Bürgern, die den Terrorangriffen ausgesetzt sind, die Kosten der Konfliktlösung aufzubürden. Diese Wertung buchstäblich auf den Kopf zu stellen, und zwar ausgerechnet zugunsten besonders skrupelloser und gefährlicher Personen, ist weit davon entfernt, das Prädikat der Selbstverständlichkeit für sich beanspruchen zu können. Man sollte deshalb wenigstens den Hauch eines Selbstzweifels verspüren, wenn man es tut.
Bei dem katholischen Theologen Florian Lamprecht ist davon nichts zu merken. Dass Folter unter keinen Umständen zulässig sei, steht für ihn von der ersten Seite seines Buches an fest. Üblicherweise wird dieses Ergebnis auf kantianisch inspirierte Argumentationsmuster wie etwa die berühmt-berüchtigte "Objektformel" des Bundesverfassungsgerichts gestützt. Lamprecht leitet es dagegen aus der scholastischen Lehre von der Doppelwirkung her.
Der Doppelwirkungslehre zufolge sind Handlungen, die sowohl gute als auch schlechte Folgen hervorrufen, nur unter engen Voraussetzungen erlaubt. Der Handelnde darf ausschließlich die gute Wirkung intendieren, die schlechte Wirkung darf kein Mittel sein, um die gute Wirkung hervorzubringen, und die Zulassung des Übels muss durch einen entsprechenden Grund aufgewogen werden. Die Pointe des Prinzips der Doppelwirkung liegt in der erstgenannten Bedingung begründet, dem Satz, dass allein die beabsichtigten guten Hauptfolgen, nicht jedoch die unbeabsichtigten schlechten Nebenfolgen für die Bewertung einer Handlung heranzuziehen sind.
Im Fall der Folter, so macht Lamprecht geltend, stelle die gewaltsame Willensbrechung indes nicht lediglich eine bedauernd in Kauf genommene Begleiterscheinung der primär intendierten Rettungshandlung dar. Sie sei vielmehr "eine als unabdingbar erachtete Voraussetzung zur Erlangung der gewünschten lebensrettenden Information". Das stimmt, und es trifft auch zu, dass sich die Folter in dieser Hinsicht von dem finalen polizeilichen Todesschuss unterscheidet, dessen grundsätzliche Zulässigkeit Lamprecht nicht in Zweifel zieht. Aber auch wenn etwa die Tötung des Geiselnehmers nicht notwendige Vorbedingung für die Rettung der Geisel ist, so ist sie doch häufig deren sichere Nebenfolge. Vermag die subtile Differenzierung zwischen einer beabsichtigten Hauptfolge und einer für gewiss angesehenen Nebenwirkung einen grundsätzlichen moralischen Unterschied zwischen beiden Handlungen zu begründen? Mit Recht wird diese Frage heute ganz überwiegend verneint, und dies ist einer der Hauptgründe dafür, dass die Lehre von der Doppelwirkung in der aktuellen moralphilosophischen Diskussion kaum eine Rolle spielt.
Obwohl sich bei Lamprecht kein Wort zu dieser Problematik findet, scheint er die Schwäche seines Arguments zu spüren. Jedenfalls beeilt er sich zu versichern, dass Folter unabhängig von der Zwecksetzung der Handlung die Würde des Gefolterten verletze und deshalb niemals ein "entsprechendes Mittel" im Sinne der Doppelwirkungslehre sei. "Gegen das vor allem seit der Aufklärung vorherrschende Postulat einer menschlichen Würde, dem zufolge jeder Mensch sein Leben aus freien Stücken, nach eigenem Willen gestalten kann, soll der Gefolterte bei polizeilich-präventiven Folterhandlungen zur Lebensrettung dazu gebracht werden, anders zu handeln, als er es aus eigenem Entschluss heraus tun würde."
Diese Begründung greift indessen ebenfalls zu kurz, und zwar aus einem doppelten Grund. Erstens bezieht sich die Gewährleistung eigenverantwortlicher Lebensgestaltung nicht auf den Bereich des Rechtswidrigen, und zweitens ist es das Kennzeichen sämtlicher Willensbeugungsmaßnahmen, dass sie ihren Adressaten dazu nötigen sollen, etwas zu tun, das er eigentlich nicht tun will. Lamprechts Würdeverständnis beweist zu viel und damit bei Lichte besehen überhaupt nichts. So einfach, wie ihre Verächter meinen, lässt sich die Unzulässigkeit der Folter in Grenzsituationen nicht begründen. Womöglich gibt dabei eher die Selbstachtung der politischen Gemeinschaft, in deren Namen gefoltert werden würde, als die Würde der zu folternden Personen den Ausschlag.
Das Folterverbot als Nachwirkung des altadligen Grundsatzes, es sei unehrenhaft, das Überleben um jeden Preis zu suchen? Das hören freilich diejenigen nicht gern, die allen moralischen Fortschritt des Menschengeschlechts auf das Konto des liberalen Individualismus buchen wollen. Aber politische Korrektheit entbindet nicht von der Pflicht zu argumentativer Genauigkeit. In jener hat Lamprecht sich eine glatte Eins verdient, in dieser nur eine Drei minus.
MICHAEL PAWLIK.
Florian Lamprecht: "Darf der Staat foltern, um Leben zu retten?" Folter im Rechtsstaat zwischen Recht und Moral. mentis Verlag, Paderborn 2009. 298 S., br., 38,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Politisch korrekt erscheint Michael Pawlik durchaus, was der Theologe Florian Lamprecht zum Thema Folter zu sagen hat. Pawlik macht allerdings deutlich, dass politische Korrektheit allein nicht ausreicht, um der Komplexität des Themas gerecht zu werden. Besser als Lamprechts Eintreten für ein totales Folterverbot gefiele dem Rezensenten eine Argumentation, die über den Luhmannschen Sinn für das Tragische der Entscheidungslage (Folter oder keine Folter?) verfügte. Wenn Lamprecht die Folterdiskussion mittels der scholastischen Lehre von der Doppelwirkung beendet, staunt Pawlik über die Schwäche der Argumentation. Das im Buch zutage tretende Würdeverständnis erscheint ihm einfach zu gut, um wahr beziehungsweise der Sachlage dienlich zu sein.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH