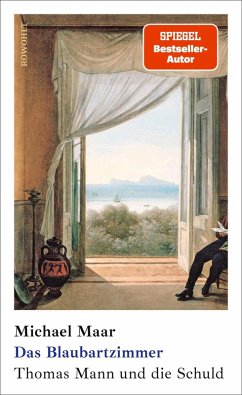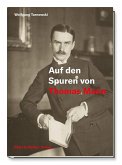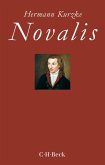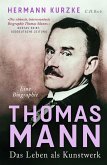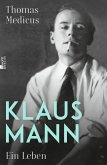Michael Maar verfolgt eine bis dahin unbeachtete Spur in Thomas Manns Leben und Werk - und zeigt beides in völlig neuem Licht
In einem Zustand größter Verzweiflung notiert Thomas Mann im April 1933: «Meine Befürchtungen gelten jetzt in erster Linie u. fast ausschließlich diesem Anschlage gegen die Geheimnisse meines Lebens. Sie sind schwer und tief. Furchtbares, ja Tötliches kann geschehen.» Er selbst war im Schweizer Exil vorerst in Sicherheit - seine frühen Tagebücher aber waren in die Hände der Nazis gefallen. Von welchen «schweren und tiefen Geheimnissen» spricht Thomas Mann hier? Etwa von seinen homoerotischen Neigungen, die doch längst ein offenes Geheimnis waren? Oder eher von etwas ganz anderem, einer persönlichen Schuld, die dem «Furchtbaren, ja Tötlichen» eine mehr als nur rhetorische, ja tatsächlich lebensgefährliche Bedeutung verleihen würde?
Michael Maar verfolgt eine allzu lang übersehene Blutspur von den frühesten Erzählungen bis zu «Doktor Faustus» und dem «Erwählten» - und biografisch zurück bis zu einem traumatischen Erlebnis des jungen Thomas Mann in Neapel, wo das Motiv der Lebensschuld womöglich seinen schmerzlich-realen Ursprung hatte. Dabei erscheint nicht nur dieses gewaltige Werk in neuem Licht - sondern auch sein Schöpfer, für den die Schuld der Urgrund alles Geistigen war.
In einem Zustand größter Verzweiflung notiert Thomas Mann im April 1933: «Meine Befürchtungen gelten jetzt in erster Linie u. fast ausschließlich diesem Anschlage gegen die Geheimnisse meines Lebens. Sie sind schwer und tief. Furchtbares, ja Tötliches kann geschehen.» Er selbst war im Schweizer Exil vorerst in Sicherheit - seine frühen Tagebücher aber waren in die Hände der Nazis gefallen. Von welchen «schweren und tiefen Geheimnissen» spricht Thomas Mann hier? Etwa von seinen homoerotischen Neigungen, die doch längst ein offenes Geheimnis waren? Oder eher von etwas ganz anderem, einer persönlichen Schuld, die dem «Furchtbaren, ja Tötlichen» eine mehr als nur rhetorische, ja tatsächlich lebensgefährliche Bedeutung verleihen würde?
Michael Maar verfolgt eine allzu lang übersehene Blutspur von den frühesten Erzählungen bis zu «Doktor Faustus» und dem «Erwählten» - und biografisch zurück bis zu einem traumatischen Erlebnis des jungen Thomas Mann in Neapel, wo das Motiv der Lebensschuld womöglich seinen schmerzlich-realen Ursprung hatte. Dabei erscheint nicht nur dieses gewaltige Werk in neuem Licht - sondern auch sein Schöpfer, für den die Schuld der Urgrund alles Geistigen war.