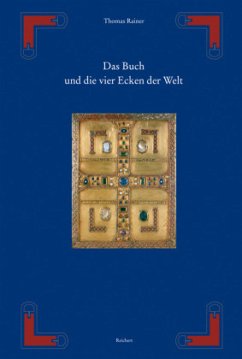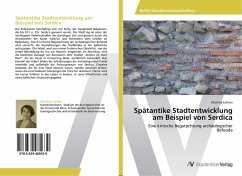Ein englisches Sprichwort warnt: "Don't judge a book by its cover." Auf den Einband richten sich noch vor dem Öffnen die Blicke der Leser, die sich seinem Eindruck nur schwer entziehen. Ausgehend von der berühmtesten Bücherhülle der Spätantike, die die Langobardenkönigin Theodelinda um 600 der Basilika San Giovanni in Monza stiftete, gelingt es dem Autor, die Voraussetzungen der Entstehung des spätantiken Prachteinbands in der christlichen Auseinandersetzung mit der Verwahrung der heiligen Schriften im Judentum zu bestimmen.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
"Die Darstellung bleibt nicht in der formalen Thematik stehen, sondern bietet immer wieder theologische Interpretationen. Das macht das gelehrte Werk auch für die Liturgiewissenschaftler interessant, weil die Bedeutung des geöffneten Codex, immer wieder thematisiert wird. (...) Die thematische Fortschreibung des "Buch"-Themas besitzt also Aktualität."
Von: Angelus Häußling
In: Archiv für Literaturwissenschaft
--------------------------------------
"Die Arbeit ist eine - durch Indizes leider nicht weiter erschlossene - Fundgrube für alle, die an Kunstgeschichte Bibelwissenschaft, Kirchengcschichte, Theologie und Bibliothekswesen interessiert sind."
Von: Joef M. Oesch
In: Zeitschrift für katholische Theologie, Band 135, 2013,Heft 4, S.446-447.
--------------------------------------
"Thomas Rainer kann aufzeigen, dass dabei die Verzierung mit den winkelförmigen Motiven an den vier Ecken der Deckel, eine große Rolle spielte. So wurde er zum Spiegel des Buchinhalts und inszenierte den Vierevangeliencodex zu einem Abbild der Welt. (...)
Spannend ist vor allem der Epilog der Dissertation, der eine Brücke zur Bibliothèque nationale de France in Paris schlägt, die von Dominique Perrault gleichsam über einem Grundriss in Form der Buchhülle mit Gammadiae errichtet wurde und daher zum Nachdenken über die "Lesbarkeit der Welt" anregt."
I. Siede
In: Bulletin codicologique. 2012, 1. S. 94-95.
--------------------------------------
"Druck und Reproduktionen sind vorzüglich. Eine großartige Arbeit. Faszinierend auch für uns Bücherfreunde ist, daß und wie der Autor eine Brücke vom spätantiken Buchdeckel und vom Mantel der Thorarolle zur Architektur der neuen französischen Nationalbibliothek schlägt: "das mittelalterliche Weiterleben der Bibliothek als Scrinium oder Capsa des kultisch verehrten Buches" (S. 217). Die vorliegende Untersuchung ist ein wichtiger Beitrag über die "Lesbarkeit der Welt" im Sinne der gleichnamigen Veröffentlichungen von Hans Blumenberg (1979) und Uwe Timm (2009)."
Dieter Schmidmaier
In: Marginalien. 206 (2012) 2. S. 96-97.
Von: Angelus Häußling
In: Archiv für Literaturwissenschaft
--------------------------------------
"Die Arbeit ist eine - durch Indizes leider nicht weiter erschlossene - Fundgrube für alle, die an Kunstgeschichte Bibelwissenschaft, Kirchengcschichte, Theologie und Bibliothekswesen interessiert sind."
Von: Joef M. Oesch
In: Zeitschrift für katholische Theologie, Band 135, 2013,Heft 4, S.446-447.
--------------------------------------
"Thomas Rainer kann aufzeigen, dass dabei die Verzierung mit den winkelförmigen Motiven an den vier Ecken der Deckel, eine große Rolle spielte. So wurde er zum Spiegel des Buchinhalts und inszenierte den Vierevangeliencodex zu einem Abbild der Welt. (...)
Spannend ist vor allem der Epilog der Dissertation, der eine Brücke zur Bibliothèque nationale de France in Paris schlägt, die von Dominique Perrault gleichsam über einem Grundriss in Form der Buchhülle mit Gammadiae errichtet wurde und daher zum Nachdenken über die "Lesbarkeit der Welt" anregt."
I. Siede
In: Bulletin codicologique. 2012, 1. S. 94-95.
--------------------------------------
"Druck und Reproduktionen sind vorzüglich. Eine großartige Arbeit. Faszinierend auch für uns Bücherfreunde ist, daß und wie der Autor eine Brücke vom spätantiken Buchdeckel und vom Mantel der Thorarolle zur Architektur der neuen französischen Nationalbibliothek schlägt: "das mittelalterliche Weiterleben der Bibliothek als Scrinium oder Capsa des kultisch verehrten Buches" (S. 217). Die vorliegende Untersuchung ist ein wichtiger Beitrag über die "Lesbarkeit der Welt" im Sinne der gleichnamigen Veröffentlichungen von Hans Blumenberg (1979) und Uwe Timm (2009)."
Dieter Schmidmaier
In: Marginalien. 206 (2012) 2. S. 96-97.