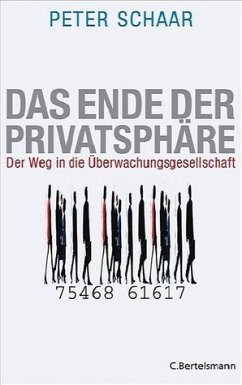Die rasante Entwicklung der Informationstechnologien geht einher mit einem wachsenden Kontrollbedürfnis. Peter Schaar, seit 2003 Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, warnt vor der Tendenz, den Einzelnen als Risikofaktor zu betrachten, der beobachtet, registriert und bewertet werden muss. Er skizziert, wie sich demokratische Staaten aus Angst vor Angriffen von außen und vor den eigenen Bürgern zu Überwachungsgesellschaften entwickeln. Ein kritischer Report über ein Thema, das immer brisanter wird.

Wie viel Überwachung muss sein? Wolfgang Sofsky und Peter Schaar über die Grenzen der öffentlichen Neugier / Von Milos Vec
So eine Eröffnungsszene erwartet man eher im Roman als in einem Sachbuch. Wolfgang Sofsky schildert einen gewöhnlichen Tag im Leben des Anton B.: Herr Jedermann erwacht, arbeitet und kehrt wieder nach Hause zurück. Anders als in Ian McEwans "Saturday" sieht man den Abgrund des Daseins auch ohne eine benennbare Katastrophe. Sofsky hält es mehr mit Kafka und lässt den Leser unter der Normalität des Unheimlichen erschauern: Es ist die Allgegenwart der Beobachtung, die B. bedrückt, denn sie normalisiert seinen Selbstzwang. Anton B. ist nicht frei, weil er beobachtet wird.
Der Soziologe Sofsky hat seine zentrale Botschaft in dieser kurzen Erzählung mit dem Titel "Spuren" verdichtet. Sein Essay beschwört ebenso wie das schlanke Buch von Peter Schaar, des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, emphatisch den Wert des Privaten. Der Zeitpunkt für diese beiden Interventionen könnte kaum besser gewählt sein. Bei jedem ihrer Perspektivwechsel können Sofsky und Schaar aktuelle Moden, Parolen und Überzeugungen bloßstellen. Deren gemeinsamer Nenner ist die Legitimation und faktische Ausweitung öffentlicher Kontrolle. Denn Kontrolle zehrt das Private auf und maßregelt unser Verhalten, das nun als "öffentlich" schärferen Maßstäben ausgesetzt wird.
Die moderne Informations- und Kommunikationstechnik hat dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet. Sofsky und Schaar zeigen sich hier informiert und maßvoll. Ihre Beispiele - Videoüberwachung, digitale Vollerfassung, Gesundheitskarten - sind aus der Mitte des urbanen Lebens gegriffen. Die Freiheiten, die beruflich Höherqualifizierte haben, werden durch stärkere Kontrollen ausgehöhlt. Was der Kassiererin und dem Fließbandarbeiter ihr Akkord, das ist dem höher entlohnten Schreibtischmenschen die totale Erfassung von Zeit und Datenströmen durch anonyme Apparate. Technisch gesehen könnte er während der Arbeitszeit privatisieren, klüger ist, es zu unterlassen.
Gläsern ist Sofskys Normalmensch Anton B. auch in seiner Freizeit. Was er auch im öffentlichen Raum tut, er hinterlässt Spuren. In seinen eigenen vier Wänden ergeht es ihm nicht viel besser; sein Mailverkehr und seine Online-Verbindungsdaten werden protokolliert, jeder Einkauf im Netz erweitert sein elektronisches Kundenprofil. Wenig davon wird vergessen, die Informationsreservate schrumpfen, der Rechtsschutz gegen die Ausspähungsgesellschaft und den Informationsdurst des Verwaltungsstaates ist dürftig. Manche Artefakte wie "künstliche Mücken" oder Backscatter scheinen Vorgriffe auf die Zukunft, aber die Befürchtung der Autoren, dass es dort eher schlimmer zugehen wird, ist realistisch: Biometrie, Online-Durchsuchung und Mautdaten stehen an. Dass viele dieser Instrumente kriminalistische Hintergründe haben, sagt schon alles, regt aber nur wenige auf.
Im Gegenteil, diese technischen Möglichkeiten werden durch einen Zeitgeist befeuert, der den Wert der Freiheit, unbeobachtet zu sein, vergessen hat. Stattdessen identifizieren Sofsky und Schaar richtigerweise die Wünsche nach Sicherheit und Wohlfahrt als Triebfedern der Zunahme von Kontrolle. Weil es an Gegenwehr und Kritik fehlt, kann nicht nur der Staat die Instrumente ausbauen; auch in der Gesellschaft grassieren Beobachtungslust und Kontrollobsessionen, was Sofsky in seinen ätzenden Miniaturen angreift. Statt eines großen Bruders im Überwachungsstaat schultern viele kleine Schwestern die Arbeit an der Ausforschungsgesellschaft.
In Wolfgang Sofsky Buch meldet sich gegen diese Miseren des Kollektivismus das neunzehnte Jahrhundert energisch und polemisch zu Wort. Sofskys Axiome entstammen einer Staatsphilosophie und Gesellschaftslehre, die heute wenige Befürworter hat und schon gar nicht unter den politischen Parteien auf Unterstützung hoffen kann. Sofsky scheidet Staat und Gesellschaft scharf voneinander. Die Autonomie der Bürger lässt sich nur durch vorstaatliche Freiheitsräume gewährleisten. Überhaupt ist sein politisches Ideal anders als das Schaars dezidiert antietatistisch, die Staatsfunktionen werden auf die Gewährleistung von Freiheit zurückgeführt, das Sicherheitsgerede scheint ihm suspekt. Die Vermehrung der Wohlfahrt geißelt er als Triebfeder des Verderbens.
Man tut Sofsky nicht unrecht, wenn man ihn als Prinzipienreiter bezeichnet, im Gegenteil. Sollte man tatsächlich unterschiedslos auf alle Durchsuchungen verzichten, alle Leibesvisitationen, etwa auf Flughäfen oder in Gerichtsgebäuden, einstellen? Ist es wirklich vernünftig, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und die zunehmend verrechtlichten Familienbeziehungen völlig aus der Kontrolle von Jugendämtern und Gerichten zu entlassen? Hier würde eine Privatheit restauriert, die, wenn nicht bereits antisozial, so doch hoch anfällig für vielfältige Missbräuche wäre. Erstrebenswert müsste vielmehr eine Austarierung sein, die individuelle Rechte achtet, besonders aber die atemberaubenden technischen Möglichkeiten in die Schranken weist.
In diesem Sinne kommt dem Leser Schaar entgegen. Von Amts wegen ist er nahe am Alltag der Überwachungsgesellschaft, kennt die Argumentationsmuster und hat deswegen das rundere, wenn auch im Theoretischen weniger grundsätzliche Buch geschrieben. Wo Sofsky polemisiert und philosophiert, da leistet Schaar Überzeugungsarbeit in moderatem Ton, denn er weiß um die Mühen der politischen Ebene. Sein Blick wird durch seine Funktion und den Rechtsrahmen seiner Arbeit als oberster deutscher Datenschützer gelenkt. Immer noch überwiegt deutlich der Fokus auf den Staat, immer noch ist die gesellschaftliche Selbstüberwachung thematisch unterrepräsentiert. Dafür erfährt man vom Diplom-Volkswirt Schaar Wichtiges über eklatantes Staatsversagen gerade auf jenen Feldern, die die argumentative Speerspitze der Datensammellust bilden. Bei der Terrorismusbekämpfung etwa lagen den angeblich informationell unterfütterten Behörden klare Hinweise vor, aber sie waren unfähig, sie zu würdigen. Man könnte nach der Lektüre von Schaars Buch fast den Eindruck haben, die Begehrlichkeiten sollten vom eigenen Versagen ablenken, mit verfügbaren Informationen zu hantieren.
Beide Werke zusammen erzeugen einen Impuls zur Revision von Gemeinplätzen, der Gegner des Datenschutzes überzeugen, Anhänger weiterbringen und Gleichgültige aus ihrer Lethargie aufrütteln sollte. Sofskys Buch verdichtet den tief empfundenen Abscheu des Autors gegen die Zwangsgesellschaft in bissigen Miniaturen, es polemisiert dabei mehr, als dass es analysiert. Schaar trägt als Bruder im Geiste pragmatisch zu einer Kriterienbildung bei, die einen Weg aus einer Gesellschaft weisen könnte, die in einer explosiven Mischung aus Angst und schlechten Manieren kulturell erprobte Konventionen der Distanz umstülpt. Längst hat sie dabei die schützenden Funktionen für das Individuum missachtet und ihre nachhaltigen Beiträge für die Demokratie ausgeblendet. Wäre der Ausspruch, dass das Private politisch ist, nicht so fragwürdig besetzt, er würde hier glänzend passen.
Peter Schaar: "Das Ende der Privatsphäre". Der Weg in die Überwachungsgesellschaft. C. Bertelsmann Verlag, München 2007. 255 S., br., 14,95 [Euro].
Wolfgang Sofsky: "Verteidigung des Privaten". Eine Streitschrift. Verlag C.H. Beck, München 2007. 158 S., geb., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Zusammen mit Wolfgang Sofskys "Verteidigung des Privaten" kann Johan Schloemann auch Peter Schaar empfehlen. Aber nur aus pädagogischen Gründen, als Paradebeispiel für das übertriebene Staatsmisstrauen der Deutschen. Die "Obsession" des bösen Staats führt auch bei Schaar zu Übertreibungen und Verzerrungen, die Schloemann nur als "grotesk" empfinden kann, auch wenn der Datenschützer im Vergleich zum dramatisierenden Sofsky noch "zivil und sachlich" daherkomme. Für Schloemann ist die Privatsphäre gar nicht so dramatisch geschrumpft wie hier behauptet. Dass Schaar in seiner Klage nie die ebenfalls im großen Stil Daten sammelnde Privatwirtschaft in den Blick nimmt, das ist für den Rezensenten ein weiterer Beweis für den selektiven Generalverdacht gegen den Staat. Und dass Schaar überhaupt nicht daraufkommt, dass Staat und Bürger in einer Demokratie vielleicht mehr verbindet, als sie trennt, das stimmt Schloemann schon fast traurig.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH