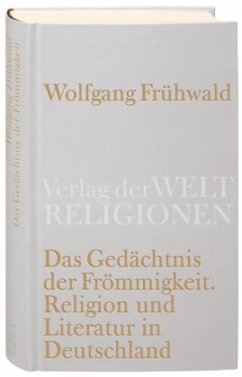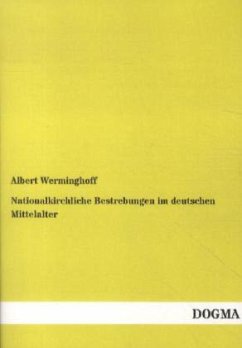Seit Martin Luther in seiner wortgewaltigen Bibelübersetzung die deutsche Sprache auf das Niveau der heiligen Sprachen des Mittelalters gebracht hat, sind Spiritualität und Sprache im Deutschen nur schwer voneinander zu trennen. Die Frömmigkeit steht an der Wiege deutscher Literatur und ihrer Sprache. Das in Literatur verwandelte und so bewahrte Gedächtnis reicht weit über die Aufklärung und ihre sprachliche Säkularisation hinaus in die Moderne. In fünfzehn Kapiteln zeichnet das Buch den Entwicklungsweg deutscher Literatur am Beispiel unterschiedlicher Stationen der Frömmigkeit nach. Sie handeln von Friedrich Spee von Langenfeld, dem Beichtvater der Hexen, von der Empfindsamkeit der Sophie von La Roche, von der "Hausfrömmigkeit" des Matthias Claudius und der "Weltfrömmigkeit" Goethes. Sie folgen dem Weg sprachlicher Säkularisation in der Romantik; die Ästhetik übernimmt an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert Funktionen, die noch in der Aufklärungszeit der Religion vorbehalten waren. Von der Romantik führt der Weg zu den Frömmigkeitsformen der Moderne: zur Erfahrung Gottes im Schmerz bei Adalbert Stifter, zum religiösen Sozialismus Alfred Döblins, zu Elisabeth Langgässers Versuch, Mythos und Frömmigkeit zu verbinden, zu der Gebetshoffnung Reinhold Schneiders, aus der er die Kraft zum Widerstand gegen die nationalsozialistische Barbarei gewonnen hat. Schließlich zur Gestaltung menschlicher Passionen bei Horst Bienek, Peter Huchel und Tankred Dorst bis zur Neuformulierung der Psalmensprache bei Arnold Stadler.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Ausgesprochen enttäuscht hat Rezensent Rolf-Bernhard Essig dieses Buch des "angesehenen Germanisten und Wissenschaftsfunktionärs" wieder zugeklappt, das er so hoffnungsfroh aufgeschlagen hatte. Denn er hatte hier von höchst kompetenter Stelle eine "kämpferisch erhellende Studie" erwartet, die sich mit dem Generalverdacht befasst, unter den hierzulande eine "fromme, gar eine katholische" Literatur gestellt werde. Stattdessen aber musste er feststellen, dass Wolfgang Frühwald hier lediglich "Aufsatzweiterverwertung" betrieben habe, deren einzelne Beiträge dann zum Bedauern des Rezensenten ihr Thema nur höchst unscharf ins Visier nehmen und, obschon für die Publikation überarbeitet, inhaltlich keine "durchgehenden Bezüge" herstellten. Schon der "unsachliche Grundton" der meisten Texte stört ihn sehr. Auch fehlt ihm eine begriffliche Festlegung, was nun genau in Bezug auf die Literatur unter Frömmigkeit verstanden werden könne. Hier ärgert sich der Rezensent oft auch über eine gewisse Dreistigkeit, mit der der Wissenschaftler aus Essigs Sicht Bekanntes als Neuigkeit präsentiert, und dabei in seinen Untersuchungen höchst spekulativ oder sogar fehlerhaft argumentiert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH