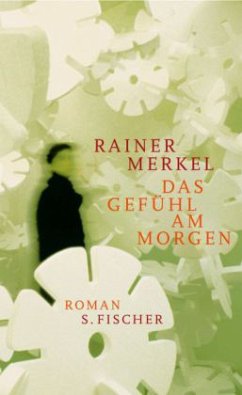Eine schlaflose Nacht, in der er sich schweigend verliebt. Eine muschelförmige Bar. Laura, die Königin von Schlachtensee. Die Erinnerung an den Moment, und er weiß nicht, ob er glücklich oder unglücklich gewesen ist. Unberechenbares Glück, ein langer Sonnenuntergang, ihr Geruch, die Weitläufigkeit ihres Körpers. Ihr Gesicht. Die Geschichte einer lauernden, einer zögerlichen und zärtlichen Annäherung, die Geschichte einer Liebe. Und bis zum Schluss ist er sich sicher: Er wird sich nicht verzaubern lassen ...

Rainer Merkel legt die achtziger Jahre auf die Couch
Die achtziger Jahre liegen im toten Winkel der Geschichte. Der Blick in den Rückspiegel bringt uns den Zweiten Weltkrieg so nah wie nie zuvor, so daß dahinter selbst das lange obsessiv umkreiste Jahr '68 verblaßt. Paradoxerweise geht die Entfernung von den Achtzigern mit ihrer Dauerpräsenz in der Unterhaltungskultur einher: Nostalgieshows, Achtziger-Feten, Bohlen und Grönemeyer - es scheint, als seien dies goldene, unbeschwerte Jahre gewesen: Zeitgeschichte als Epoche der Mitfeiernden. Die beiden größten Bucherfolge über jene Jahre - Florian Illies' "Generation Golf" und Sven Regeners "Herr Lehmann"-Romane - waren in ihrer ironisch-anekdotischen Kirchturmperspektive nur eine intelligentere Art der Arbeit am Mythos.
In Rainer Merkels neuer Erzählung, die irgendwann in den endlosen späten Achtzigern in West-Berlin spielt, kommt kein Popsong vor, kein Werbeslogan und keine Fernsehserie. Datieren kann man die Geschichte einzig an den Katastrophen. ",Wußtest du das? Tschernobyl heißt übersetzt Schwarzes Gras.'" Als Lukas dies zu seiner Freundin Laura sagt, hat sich der private Super-Gau bereits ereignet: Laura erwartet ein Kind, von dem er nicht mal sicher weiß, ob es seins ist. Das Paar, das sich gerade erst im Studentenwohnheim kennengelernt hat, ist mit dem Entscheidungszwang überfordert. Die verdrängte Unbestimmtheit ihrer Beziehung tritt zutage; zugleich wird offenbar, wie heillos Lukas in seinen Familienroman verstrickt ist: Seine Eltern zahlen den Kredit ihrer Selbstverwirklichung in der kleinen Münze der Neurose ab. Die Mutter, auf großem Fuß lebend und spielsüchtig, tingelt durch Amerika; der Vater, Psychiater und erfolgreicher Buchautor, alimentiert und analysiert die übrigen Familienmitglieder, ohne das Paradox aufgezwungener Freiheit zu durchschauen. Lukas leidet an diffusen Schuldgefühlen und kann sich nicht aus der auch materiellen Abhängigkeit befreien, die sich in Sexualstörungen äußert. Als er Laura seinem Vater vorstellt, stopft der sie mit seinen verblasenen Theorien voll - "Stellen Sie ihr eigenes Leben nicht unter Faschismusverdacht" - und engagiert sie gönnerhaft als Praxishilfe.
Da Merkel nur aus Lukas' Sicht erzählt und dessen von Tagträumen durchschossene Wahrnehmung oft unmerklich über die Realität legt, wirkt diese Geschichte einer verhinderten Liebe oft wie unter Glas. Das äußere Geschehen ist immer auch Symptom innerer Zustände; selbst eine Autofahrt wird zum Seelengleichnis: "Er hatte Schwierigkeiten, die Augen aufzuhalten. Kolonnen von Fahrzeugen, Anordnungen, komplizierte Verkettungen, die sich wie der Anfang einer großen Erzählung über seine Augen legten. Er sah vor dem Rotlicht wartende Fahrzeuge. Er sah eine verführerisch frei bleibende Abbiegespur wie in einem jahrhundertealten Traum." Man muß sich etwas gewöhnen an diese Erzählweise, die jedes Geschehen wie ein Rätselbild deutet und ebendiese endlose Reflexionsschleife als Problem ausmacht: Laura kommt als Person nie in den Blick, sie bleibt immer nur Projektionsfläche für Lukas' selbstquälerische Seelen-Diashow.
Rainer Merkel, der 1964 in Köln geboren wurde und heute in Berlin und Dublin lebt, zielt bei aller vordergründigen Beiläufigkeit mitten ins psychopathologische Zentrum der Epoche, jener Mischung aus unhinterfragten Autonomiedogmen und verschleierten Abhängigkeiten, Befreiungsdruck und Selbstfesselung, der die damals populär gewordene "Dark Wave"-Kultur mit ihren Sado/Maso-Phantasien entsprach. Die versäumten Sechziger sind ein Phantomschmerz, die Politisierung nur noch Zitat. Wie der studierte Psychologe Merkel schon in seinem ersten Buch "Das Jahr der Wunder" die irreale Flüchtigkeit der postindustriellen Start-up-Welt der Neunziger verdichtete (das Buch erschien im September 2001, punktgenau zum definitiven Ende der schönen neuen Economy-Welt), so faßt er hier das Paradox einer Generation in einer schulbuchmäßigen double-bind-Situation: "Verwirkliche dich selbst!" scheint der Vater dem Sohn zuzurufen: "Mach es also genau wie ich, das Geld dafür geb' ich dir schon."
Meisterhaft beschreibt Merkel diesen Narzißmus des allwissenden Übervaters, der seine Umgebung zum Objekt seiner Psychoexperimente macht und eigene Versäumnisse so keimfrei entsorgt wie die Müllbeutel im Abfallschacht. Seine Seitensprünge, die die Mutter vertrieben, gibt er als offenen Umgang mit seiner "Sexualsucht" aus; über sein Geld dagegen, das das Familienwrack zusammenhält, wird nicht gesprochen. Zur Schwangerschaft spendiert der Vater dem überrumpelten Paar Sekt; zur Abtreibung in Holland fahren die beiden mit seinem Auto - im Automatikwagen ist Lukas selbst das Schalten abgenommen.
Merkel hat ein Auge für die Maskeraden der Macht, ein Ohr für den Befehl im einschmeichelnden Verständniston. In der Verkleidung der Autorität hat jede Epoche ihre eigene Mode: Merkels Bücher enthalten auf untergründige Weise eine an Foucault geschulte Entlarvung einer Herrschaftstechnik, die sich als tabubrechende Offenheit drapiert. Das birgt auch eine subtile Komik, die an Genazino erinnert. In der Physik bezeichnet man das Verhältnis von Masse zu Volumen als Dichte. Rainer Merkel hat eine Erzählung geschrieben, deren Dichte vieles übertrifft, was sich heute als Roman aufplustert. Daß sie auf dem Schutzumschlag - nicht im Innern - als ein solcher bezeichnet wird, verbuchen wir als Freudsche Fehlleistung des Marketings.
Rainer Merkel: "Das Gefühl am Morgen". S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2005. 158 S., geb., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rainer Merkel Erzählung übertrifft aus der Sicht von Rezensent Richard Kämmerlings an Dichte die meisten Roman heutzutage. Die Erzählung, deren vordergründige Beiläufigkeit er zu ihren großen Stärken zählt, ziele mitten ins "psychopathologische Zentrum" der späten achtziger Jahre. Meisterhaft findet der Rezensent den Narzissmus eines allwissenden Übervaters geschildert, in dessen Schatten ein Sohn vergeblich versucht, erwachsen zu werden. Zur großen Freude des Rezensenten kommt kein Popsong, kein Werbeslogan und auch keine Fernsehserie vor. Datieren könne man die Geschichte einzig an Katastrophen wie der von Tschernobyl. Kämmerlings fasziniert an Merkels Erzählung besonders dessen an Foucault geschärfte Fähigkeit, Herrschaftstechniken offenzulegen, die sich als tabubrechende Offenheit verkleiden. Merkel hat "ein Ohr für den Befehl im einschmeichelnden Verständniston", lobt der beeindruckte Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH