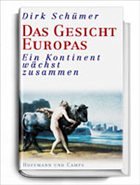Europa, das ist für viele ein leerer Begriff. Und doch zwingen die aktuellen politischen Debatten - um den Krieg auf dem Balkan, um BMW/Rover oder um die neue österreichische Regierung - dazu, sich Europa als Einheit vorzustellen, als eine Einheit der Unterschiede, kulturell wie politisch. Dirk Schümer versucht das neue Gesicht Europas auf ungewohnte Weise zu beschreiben. Er besucht die Städte und Regionen, die Europa prägen und von denen aus die maßgeblichen Entscheidungen getroffen werden. So geht es, beispielsweise, um Straßburg, wo einst eine Art europäischer Utopie erwuchs und heute der Europarat residiert. Oder um Den Haag, den Sitz von Europol. Um Frankfurt, wo sich der Reichtum Europas trostlos spiegelt. Um den profitablen Ministaat Luxemburg, um Berlin, die alte-neue Hauptstadt, um die Osterweiterung der Europäischen Union. Die Besichtigungen der Metropolen führt auch in die Region Aachen/Lüttich/Maastricht, wo sich der grenzüberschreitende europäische Alltag am besten beschreiben lässt. Der geographische Rundgang macht die politische Analyse verständlich. Schümers Buch schaut hinter die Fassaden der Institutionen, skizziert die kulturellen Wurzeln der Gegenwart und beschreibt künftige Wege eines Europas, das zwischen Transnationalität und Regionalität pendelt. "Das Gesicht Europas" - hier wird es erstmals prägnant und anschaulich mit Konturen versehen.

F.A.Z.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Einleitend sendet Klaus Harprecht ein großes Lob an seinen Kollegen von der FAZ und Autor des vorliegenden Buchs, der - wie der Rezensent betont - die große Fähigkeit besitzt, das "Wesentliche" im "Beiläufigen" zu erkennen und komplexe Themen farbig und spannend zu behandeln. Doch klingt dies fast wie eine Entschuldigung für den nachfolgenden Verriss. Denn Harprecht listet anschließend etliche Aspekte auf, bei denen er anderer Meinung als Schümer ist. So etwa bei dessen Behauptung, Europa sei `ein einziges Schlachtfeld von Ressentiments ohne Ansatz für ein echtes Zusammengehörigkeitsgefühl`. Auch die Katastrophe von 1914 als Ursprung für die "Notwendigkeit der europäischen Vereinigung" wird von Schümer nach Ansicht des Rezensenten nicht ausreichend erkannt. Gänzlich unverständlich findet Haprecht gar, dass Schümer sich Kurt Schumachers "blamablem Verdikt über den Schuman-Plan als ein Konglomerat der Länder des vierfachen `k`: `konservativ, klerikal, kapitalistisch, kartellistisch`" anschließt - eine Auffassung, die nach Harprecht spätestens seit Willy Brandt als überholt gelten darf. Schümers Überlegungen zu einer Reform der Europäischen Union findet der Rezensent schließlich "anregend, kühn, oft vernünftig, manchmal jenseits des Nachvollziehbaren".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH