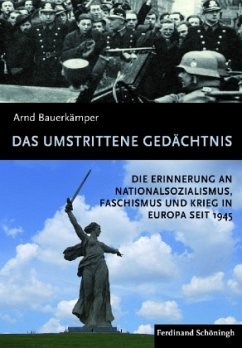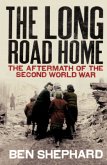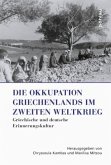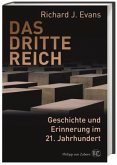Dieses Buch ist das erste Kompendium zu den Erinnerungswelten Europas nach 1945 - von Spanien bis Russland, von Norwegen bis Italien. Es zeigt, wie in stillem Gedenken, in politischen Kontroversen oder bei der Suche nach Erinnerungsorten die Erfahrungen von Nationalsozialismus und Faschismus, Holocaust und Kollaboration bis heute maßgeblich das Geschichtsbewusstsein des Alten Kontinents prägen.
Das Übersichtswerk erschließt, wie Europäer die traumatisierenden Ereignisse der 1930er und 1940er Jahre deuteten und debattierten. Neben Gemeinsamkeiten und Unterschieden nationaler Erinnerungskulturen werden auch Spannungen zwischen der offiziellen Gedächtnispolitik und den Erinnerungen einzelner gesellschaftlicher Gruppen dargestellt. Der juristischen Aufarbeitung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist ein eigenes Kapitel gewidmet.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Das Übersichtswerk erschließt, wie Europäer die traumatisierenden Ereignisse der 1930er und 1940er Jahre deuteten und debattierten. Neben Gemeinsamkeiten und Unterschieden nationaler Erinnerungskulturen werden auch Spannungen zwischen der offiziellen Gedächtnispolitik und den Erinnerungen einzelner gesellschaftlicher Gruppen dargestellt. Der juristischen Aufarbeitung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist ein eigenes Kapitel gewidmet.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.