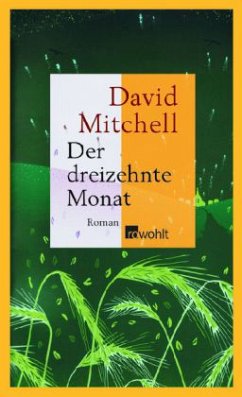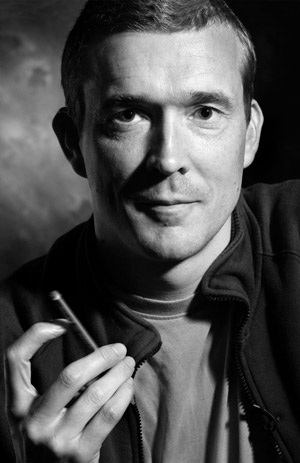Ein Jahr lang erwachsen werden: David Mitchell über die Schwierigkeiten im Leben eines 13-jährigen.
1982: Es ist ein regennasser Januar in Black Swan Green, einem Dorf in der toten Mitte Englands. Jason Taylor - heimlicher Stotterer und zögernder Poet - befürchtet ein Jahr der schlimmsten Langeweile. Doch er hat weder mit einem Haufen Schulschläger noch mit köchelndem Familienzwist, dem Falklandkrieg, einem exotischen belgischen Einwanderer, einer drohenden Zigeunerinvasion oder gar mit jenen rätselhaften Geschöpfen gerechnet, die man gemeinhin Mädchen nennt. David Mitchells ebenso bezaubernder wie turbulenter neuer Roman kartographiert dreizehn Monate im Schwarzen Loch zwischen Kindheit und Adoleszenz, das Ganze im Abendrot eines heruntergekommenen Ex-Weltreichs, für dessen Bewohner der Zweite Weltkrieg immer noch nicht beendet ist. Dies ist Mitchells subtilstes, melancholischstes und lustigstes Buch - überquellend von dem Stoff, aus dem das Leben ist.
1982: Es ist ein regennasser Januar in Black Swan Green, einem Dorf in der toten Mitte Englands. Jason Taylor - heimlicher Stotterer und zögernder Poet - befürchtet ein Jahr der schlimmsten Langeweile. Doch er hat weder mit einem Haufen Schulschläger noch mit köchelndem Familienzwist, dem Falklandkrieg, einem exotischen belgischen Einwanderer, einer drohenden Zigeunerinvasion oder gar mit jenen rätselhaften Geschöpfen gerechnet, die man gemeinhin Mädchen nennt. David Mitchells ebenso bezaubernder wie turbulenter neuer Roman kartographiert dreizehn Monate im Schwarzen Loch zwischen Kindheit und Adoleszenz, das Ganze im Abendrot eines heruntergekommenen Ex-Weltreichs, für dessen Bewohner der Zweite Weltkrieg immer noch nicht beendet ist. Dies ist Mitchells subtilstes, melancholischstes und lustigstes Buch - überquellend von dem Stoff, aus dem das Leben ist.

David Mitchells leichter Pubertätsroman
"Der dreifach unsichtbare Junge, das ist Jason Taylor." Unsichtbar, weil er leicht stottert, unsichtbar, weil er von seinen Mitschülern drangsaliert wird, und unsichtbar, weil er unter den heftigen Streitereien seiner Eltern leidet. Alles gute Gründe für einen Dreizehnjährigen, sich im kleinsten Loch zu verstecken, bis das Blatt sich wieder wendet. Denn zu den Gesetzmäßigkeiten pubertierender Jungscliquen gehört es, dass die Hackordnung variabel ist. Wer gerade im Cabrio des großen Bruders gesehen wurde, etwas besonders Mutiges getan hat oder die Klassenschönste küssen durfte, ist oben.
Das war offensichtlich schon im England des Jahres 1982 so. In dieser Zeit, die auch für die Kinder wesentlich vom Falkland-Krieg geprägt ist, spielt der neue Roman von David Mitchell. Der Autor von "Chaos" und "Der Wolkenatlas" bewegt sich damit weg von seiner bisherigen Erzählarchitektur: einzelne Handlungsstränge zusammenführen, fallen lassen und wieder aufnehmen. "Der dreizehnte Monat" ist ein im besten Sinne konventioneller Roman, stringent erzählt und ohne Zeit- und Handlungssprünge.
Jason Taylor muss stets abwägen, ob seine Gedanken auch unfallfrei durch seinen Mund kommen. Wenn nicht, behält er sie lieber für sich oder muss sie umständlich ausdrücken. Denn nur bei Wörtern, die mit N oder S beginnen, bleibt er hängen - zur hämischen Freude seiner halbstarken Mitschüler. Vorlesen in der Schule ist der Horror, und zu allem Überfluss hat Jason noch ein pikantes Geheimnis: Unter dem Namen Eliot Bolivar veröffentlicht er Gedichte im Gemeindeblatt. Das ist, genau wie Wollmützen, das Schulfach Französisch und so einiges andere in der Welt der Pubertierenden, "schwul".
Der stotternde Poet ist klug genug, die Mechanismen zu durchschauen und sich entsprechend zu verstellen. Also versucht er, mittelklug zu wirken, mittelnett, mittelwitzig. Ein ganz normaler Junge eben, auf dessen Gedankenwelt und Sprache sich David Mitchell eingelassen hat: "Blumenkohl schmeckt wie frische Kotze" heißt es da zum Beispiel. Die Schwärmerei für eine Klassenkameradin, die Begeisterung für einen zugefrorenen See und die häufig vergeblichen Versuche, cool zu wirken, sind in diesem Roman in authentische Worte gepackt, was häufig zu sehr vergnüglichen Dialogen führt.
Seine widerstreitenden Temperamente, und da ist Jason dann doch ungewöhnlich, tragen Namen und führen innere Zwiesprache. "Henker" ist der Stotterer, "ungeborener Zwilling" ist frech und mutig, und "Wurm" ist, wie der Name schon sagt, zurückhaltend bis feige. Jasons Aufgabe ist es oftmals, zwischen ihnen abzuwägen. Aus den nicht immer richtigen Entscheidungen resultieren so groteske wie turbulente Situationen.
Eine spannende Achterbahn hat David Mitchell da aufgebaut. Dass der Roman im letzten Jahr zu Recht für den Booker Prize nominiert wurde, können nun auch die deutschen Leser feststellen.
JULIA BÄHR
David Mitchell: "Der dreizehnte Monat". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Volker Oldenburg. Rowohlt Verlag, Reinbek 2007. 493 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Dem Rezensenten Jörg Magenau gefällt dieser Roman, auch wenn er ihn im Vergleich zu früheren Arbeiten des englischen Autoren David Mitchell eher "unterkomplex" findet. Dennoch werde vom Zerfall der Familie eines stotternden Teenagers, der im Schreiben eine ganz neue Welt abseits des "täglichen Überlebenskampfs"entdeckt, stimmig erzählt. Den Tonfall des beschriebenen Jahres 1982 zu treffen, gelingt Mitchell nach Magenaus Meinung jedenfalls ausgesprochen gut - nicht nur, weil er, wie der Rezensent berichtet, als "erzählerisches Chamäleon" bekannt ist, sondern auch, weil er sich in diesem konkreten Fall von seiner eigenen Jugend inspirieren lassen konnte. Was der Übersetzer Volker Oldenburg in der Übertragung ins Deutsche daraus gemacht hat, hält Magenau für ähnlich gelungen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH