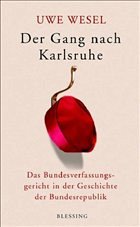Hüter der Verfassung oder Lenker der Politik?
Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe. Das ist die Adresse, an die man sich wendet, wenn man nicht einverstanden ist mit denen, die die Macht haben. Ein Neubau aus den sechziger Jahren, zwei Stockwerke mit Flachdach in drei versetzten Quadraten. Einige Meter dezente Bannmeile, abgegrenzt durch eine Kette aus Schmiedeeisen. Dahinter ein paar Polizisten mit Sprechfunkgeräten. Auf der Wiese vor dem Haus ein kleines goldfarbenes Schild mit schwarzem Adler, darunter ein einziges Wort: Bundesverfassungsgericht.
Es ist das höchste deutsche Gericht, oberstes Verfassungsorgan, im Rang gleich mit Bundespräsident und Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat. 16 Richter entscheiden hier, je acht in zwei Senaten. Sie kontrollieren Regierung und Parlament in so genannten Organstreitigkeiten oder Normenkontrollverfahren. Vertreter der Exekutive, aber auch einzelne Bürger können sich mit einer Verfassungsbeschwerde an das Gericht wenden. Wiederbewaffnung, Schwangerschaftsabbruch und Kopftuch in der Schule, um nur einige Streitfälle zu nennen, standen auf der Agenda der Richter - in den ersten 50 Jahren des Gerichts gingen fast 130 000 Verfassungsbeschwerden ein, ungefähr 3000 hatten Erfolg. Uwe Wesel beschreibt und bewertet das bedeutungsvolle Wirken des obersten deutschen Gerichts - vom Verbot der KPD 1956 bis zum Urteil gegen den großen Lauschangriff 2004.
1949 verabschiedete der Parlamentarische Rat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und beschloss die Errichtung eines starken, unangreifbaren Verfassungsgerichts. Zu bedrückend war die Erinnerung an die Weimarer Republik, in der Kommunisten und Nationalsozialisten wesentlich an der Aushöhlung der Verfassung beteiligt waren. In den Jahren nach 1951 hat das Bundesverfassungsgericht seine Position als unparteiische und überparteiliche Instanz in politischen Auseinandersetzungen behauptet. Uwe Wesels Buch ist die erste umfassende Darstellung der Rolle des höchsten deutschen Gerichts.
Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe. Das ist die Adresse, an die man sich wendet, wenn man nicht einverstanden ist mit denen, die die Macht haben. Ein Neubau aus den sechziger Jahren, zwei Stockwerke mit Flachdach in drei versetzten Quadraten. Einige Meter dezente Bannmeile, abgegrenzt durch eine Kette aus Schmiedeeisen. Dahinter ein paar Polizisten mit Sprechfunkgeräten. Auf der Wiese vor dem Haus ein kleines goldfarbenes Schild mit schwarzem Adler, darunter ein einziges Wort: Bundesverfassungsgericht.
Es ist das höchste deutsche Gericht, oberstes Verfassungsorgan, im Rang gleich mit Bundespräsident und Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat. 16 Richter entscheiden hier, je acht in zwei Senaten. Sie kontrollieren Regierung und Parlament in so genannten Organstreitigkeiten oder Normenkontrollverfahren. Vertreter der Exekutive, aber auch einzelne Bürger können sich mit einer Verfassungsbeschwerde an das Gericht wenden. Wiederbewaffnung, Schwangerschaftsabbruch und Kopftuch in der Schule, um nur einige Streitfälle zu nennen, standen auf der Agenda der Richter - in den ersten 50 Jahren des Gerichts gingen fast 130 000 Verfassungsbeschwerden ein, ungefähr 3000 hatten Erfolg. Uwe Wesel beschreibt und bewertet das bedeutungsvolle Wirken des obersten deutschen Gerichts - vom Verbot der KPD 1956 bis zum Urteil gegen den großen Lauschangriff 2004.
1949 verabschiedete der Parlamentarische Rat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und beschloss die Errichtung eines starken, unangreifbaren Verfassungsgerichts. Zu bedrückend war die Erinnerung an die Weimarer Republik, in der Kommunisten und Nationalsozialisten wesentlich an der Aushöhlung der Verfassung beteiligt waren. In den Jahren nach 1951 hat das Bundesverfassungsgericht seine Position als unparteiische und überparteiliche Instanz in politischen Auseinandersetzungen behauptet. Uwe Wesels Buch ist die erste umfassende Darstellung der Rolle des höchsten deutschen Gerichts.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Kaum ein Jurist sei wohl so gut geeignet gewesen, dieses Buch zu schreiben, wie der jetzt emeritierte Rechtsprofessor Uwe Wesel, meint der Rezensent Roderich Reifenrath. Mit der Geschichte des Bundesverfassungsgericht kennen sich viele aus, aber der "linksliberale Staatsbürger" Wesel sei zum einen einer der wenigen Juristen, die in der Lage sind, sich nicht nur verständlich, sondern nachgerade unterhaltsam auszudrücken. Seine Auswahl von entscheidenden Gerichtsurteilen hält der Rezensent darüber hinaus für bestens gelungen. Wesel konzentriert sich auf jene Urteile, die - wie etwa das "Lüth-Urteil" von 1958 in Sachen Meinungsfreiheit - für eine Stärkung der Grundrechte eintreten. Kritische Bemerkungen lässt Reifenrath eher nebenbei fallen, etwa die, dass sich Wesel an Karl-Friedrich Fromme, seinem alten Feind von der FAZ, doch "irgendwie ziellos abarbeitet". Fazit: "Ein Buch zum Lesen. Durchwühlen, durchquälen gar muss sich da niemand."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH