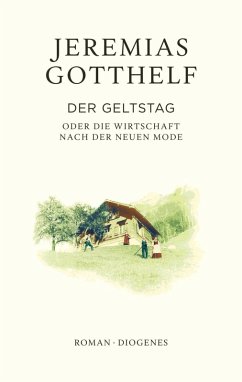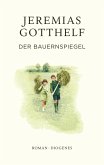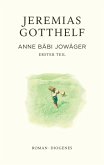Der Diogenes Verlag hat seine Jeremias Gotthelf- Edition mit dem Roman „Der Geltstag“ fortgesetzt, der 1846 erstmals erschien. Es handelt sich um eine Erzählung innerhalb seiner Sammlung „Bilder und Sagen aus der Schweiz", die zwischen 1842 und 1846 in sechs Einzelbänden veröffentlicht wurde. Der
Roman handelt vom Geld und dessen Missbrauch sowie den daraus resultierenden Folgen für eine Familie…mehrDer Diogenes Verlag hat seine Jeremias Gotthelf- Edition mit dem Roman „Der Geltstag“ fortgesetzt, der 1846 erstmals erschien. Es handelt sich um eine Erzählung innerhalb seiner Sammlung „Bilder und Sagen aus der Schweiz", die zwischen 1842 und 1846 in sechs Einzelbänden veröffentlicht wurde. Der Roman handelt vom Geld und dessen Missbrauch sowie den daraus resultierenden Folgen für eine Familie und die Dorfgemeinschaft.
Dem Wirtshaus „Zur Gnepfi“ droht der Geltstag – der Konkurs. Das egoistische Wirtspaar Steffen und Eisi hat das Geld leichtfertig mit vollen Händen ausgegeben. Nach dem Tode von Steffen durch Trunksucht kommt es zum Konkurs des Wirtshauses. Die Versteigerung ist ein Symbol für den moralischen und wirtschaftlichen Niedergang nicht nur des Wirtspaares, sondern der Gesellschaft, denn alle versuchen, einen Gegenstand zu ergattern. Hauptsache, man hat ein Schnäppchen geschlagen. Am Ende drückt Gotthelf, der den Roman im „vaterländischen Zorn“ geschrieben hatte, die Hoffnung aus, dass eine neue Generation heranwachse, die sich von den Altvätern bilden lässt. Harte Arbeit ist Gotthelfs Erfolgsrezept.
Die Diogenes-Ausgabe orientiert sich an dem Erstdruck von 1846, der zwar in deutscher Sprache erschien, aber viele Redewendungen und Ausdrücke des Berner Dialekts enthielt. Daher ist ein mehrseitiges Glossar mit Erläuterungen angefügt, sowie Hinweise zu Berner Währungen, Gewichten und Maßen.
Der Roman zeigt Gotthelfs milieugetreue und fabulierfreudige Erzählkunst. Er wurde schnell ein großer Erfolg und er liefert noch heute, fast zweihundert Jahre nach seinem Erscheinen, ein Abbild des wirklichen Lebens und keine romantisch geschönte Darstellung des Dorflebens im 18. Jahrhundert. In seinem Nachwort betont der Schweizer Schriftsteller, dass der Roman „eine einzige, über vierhundert Seiten laufende Moralpredigt“ sei.