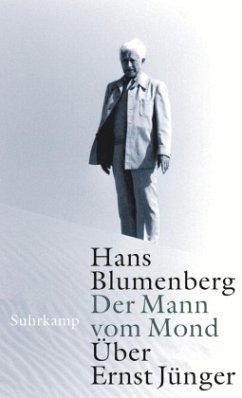In der Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts ist kaum eine überraschendere Konstellation denkbar als die zwischen Hans Blumenberg und Ernst Jünger. Ernst Jünger, der "Mann vom Mond", gehört zu denjenigen Autoren der Gegenwart, die polarisiert und Anlaß zu überaus heftigen Kontroversen gegeben haben. Zwischen Nationalbolschewismus und Postmoderne oszilllierend, sind Ernst Jüngers Werke Streitschriften.

Greulich-schön: Hans Blumenberg liest Ernst Jünger
Der erste Band aus dem geradezu unerschöpflich scheinenden Nachlass Hans Blumenbergs, den dieser gar nicht selbst zur Veröffentlichung vorbereitet hatte, ist gleich eine Überraschung. Leser der "Neuen Zürcher Zeitung" konnten sich zwar 1995 über einen Beitrag zu Ernst Jüngers hundertstem Geburtstag wundern; dass sich aber der 1996 verstorbene Münsteraner Philosoph über eine Spanne von fünfundvierzig Jahren hinweg mit Jüngers Werk und Person beschäftigt hatte, war weithin unbekannt.
Jenen, die Blumenberg als "starken Autor" präsentiert sehen möchten, mag nicht gefallen, dass diese Beschäftigung in fünfzig heterogenen Texten nebst Marginalien, Varianten und editorischen Kommentaren dokumentiert wird; faszinierend und gut lesbar ist die Textdarbietung allemal. Ob die Art der Edition ein Modell für die weitere Arbeit an dem in Marbach befindlichen Nachlass sein kann, wird sich zeigen. Den vorliegenden Texten ist sie angemessen.
Für Blumenberg wird an Jüngers Werk und Person nicht weniger als die Gestalt des zwanzigsten Jahrhunderts wahrnehmbar. Als einziger deutscher Schriftsteller habe dieser sich so beharrlich wie wandlungsfähig mit dem Problem des Nihilismus, mit der "Vernichtung unserer alten Welt" auseinandergesetzt. In der Wüste, im Kriegertod, in Rausch und Abenteuer, in der Zerstörung der Person in der technisch-biologischen Konstruktion des Arbeiters habe Jünger dem Nichts nachgejagt. Dessen überraschende Wendung gegen den barbarischen Nihilismus inmitten der Greuel, welche die Verwirklichung des totalen Staates mit sich brachte, sein bedeutendstes Werk "Auf den Marmorklippen", zählte Blumenberg kurz nach dem Krieg gar zu den "wichtigsten Ereignissen der deutschen Geistesgeschichte".
Die Gestalten, in denen Jünger seine Epoche erfasst und sich zugleich selbst stilisiert, Krieger, Arbeiter, Spieler, Waldgänger oder Anarch, werden für Blumenberg lesbar als Fragen danach, wie in einer Welt der "Selbstaufhebung der authentischen Erfahrungsmöglichkeiten" zu leben sei, ja, wie der Mensch in der Welt der Maschinen und Waffen und ihrer Affinität zur Simulation überhaupt fortbestehen kann. Kurz nach dem Krieg, unter den Bedingungen der "geistigen Not", geschieht das sehr ernsthaft und systematisch; später, besonders anlässlich der Lektüre der Tagebücher, zunehmend spielerisch, glossierend oder anekdotisch, in leichthändiger Verbindung mit den eigenen Themen: Weltzeit und Lebenszeit, Lesbarkeit der Welt, Wirklichkeiten, in denen wir leben.
In Jüngers Beschreibung eines am Flipper spielenden Arbeiters in Paris aus "Siebzig verweht II" findet Blumenberg so eine der organischen Konstruktion umwegig ähnliche Gestalt wieder. Die Maschine erscheint als solitärer Partner des Menschen, "sie ist sogar seiner Einsamkeit gewachsen und nimmt ihm durch ihre Rhythmik die Sorge um die Teilung seiner Zeit, die Angst vor der Langeweile". Weitergedacht ergibt sich daraus etwas wie eine humane Perspektive in einer Welt voller Simulatoren: "Beendigung des Konfliktes des Anrechts aller auf alles", Zwang zu Schlichtungsformen in einer Realität, in der die Regulation über den Preis nicht mehr lange funktionieren kann.
Trotz der Ironie, mit der Blumenberg gelegentlich Jüngers Ausflüge ins Kosmische und Titanische kommentiert, ergreift und erstaunt die außerordentliche Bewunderung, die Blumenberg dem praktizierenden Platoniker, der Präzision seiner Beobachtungen und des Stils, der Energie und Bannkraft seiner Sätze, seiner Courage und seiner Insistenz, "Tiefe hinter oder unter den Erscheinungen zu erspüren", entgegenbringt.
Der Beharrlichkeit, mit der der Metaphysiker im Gewande des Empirikers sich der Vernichtung stellt, "um das Unzerstörbare zu finden", gilt eine vorbehaltlose Sympathie, die selbst praktisch werden kann. Manche Deutungen lesen sich wie das Brevier eines Agnostikers, der sich im Blick auf Jüngers Erfahrungen erstaunlich gut gelaunt daran erinnert, dass das Leben bar eines Trostes gelebt werden muss.
Umso mehr scheint es den hingerissenen Leser der Tagebücher peinigend zu berühren, dass Ernst Jünger, vor allem in seiner notorischen Lust an der Analogie, nicht selten "die Grenze von Takt, Ton und Geschmack" geradezu drastisch überschreitet oder seine Pointen "zu billig, zu plausibel, zu sehr aufs beifällige Nicken berechnet". Alteuropäische Tugenden müssen offenbar über ihre Beseitigung hinweg respektiert werden.
Ebenso bestimmt fällt schon früh Blumenbergs Widerspruch gegen Jüngers abwegige gnostische Kunststückchen aus, nach denen die Freiheit in gegenseitiger Sinnverleihung nicht nur gegen, sondern auch durch die Despotie gegeben sein soll. Die Probe einer "realen, ins Politische eingreifenden Verbindlichkeit" habe Jünger jedenfalls nicht bestanden.
"Heliopolis" hatte Blumenberg im Jahre 1949 als "peinlich mißlungen" empfunden und sich daraufhin vorgenommen, nie wieder ein Buch dieses Autors zur Hand zu nehmen. Dass er diesem Vorsatz auf produktive Weise untreu wurde, ist ein Glück für alle philosophisch und ästhetisch interessierten Leser, die sich bei intellektueller Normalität so langweilen, wie ihnen postmoderne Allotria auf die Nerven fallen.
FRIEDMAR APEL
Hans Blumenberg: "Der Mann vom Mond". Über Ernst Jünger. Hrsg. von Alexander Schmitz und Marcel Lepper. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007. 186 S., geb., 19,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Konstruktiv kritisch setzt sich Ahlrich Meyer mit Hans Blumenbergs hier versammelten Aufsätzen zu Ernst Jünger auseinander. Meyer wertet nicht, doch lässt der respektvolle Ton der Besprechung und deren Überschrift "Subtile Lektüre" darauf schließen, dass Meyer Blumenberg intellektuell durchaus schätzt. Für Meyer ist Jünger jedoch durchaus problematisch, und die "widerspruchsvolle Rezeption" Blumenbergs, der sich dieser Problematik durchaus bewusst war, reizt den Rezensenten zum Widerspruch seinerseits. Etwa gegen den Gedanken, den er bei Blumenberg zu finden meint, dass ein "kommunikatives Beschweigen" die einzig mögliche Form der Vergangenheitsbewältigung im Nachkriegsdeutschland gewesen ist. Hier entdeckt Meyer Ähnlichkeiten mit Jünger, der ja zeitlebens ein "Meister dieser Art zu schweigen" gewesen sei.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH