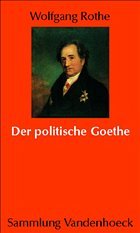Der politische Goethe ist einem größeren Publikum so gut wie unbekannt, auch als Gegenstand der Forschung wurde das Thema bisher weitgehend vernachlässigt.
Wolfgang Rothe setzt sich aus einer bewundernswert umfassenden Kenntnis des Gesamtwerks heraus mit Goethes politischem Kontext auseinander. Die Befunde sind irritierend, ja desillusionierend: Der Erste Minister des Zwergstaates Sachsen-Weimar-Eisenach eignet sich schwerlich als Leitgestirn einer deutschen Republik. Aus Dichtungen, Briefen, Tagebüchern und Annalen entsteht das Bild eines erzkonservativen Verteidigers des spätabsolutistischen Fürstentums. Ein Bild, dem reaktionäre Züge nicht fehlen und das in völligem Widerspruch zu der seit Thomas Mann beliebten Stilisierung Goethes zum »Repräsentanten des bürgerlichen Zeitalters« steht.
Mit seinen kraß antiliberalen Affekten, seiner Abneigung gegen eine Verfassung, seinem Nein zu Presse- und Druckfreiheit und seiner abgrundtiefen Verachtung der »Menge« war der Geheime Rat v. Goethe schon im Vormärz als Integrationsfigur der »verspäteten Nation« ungeeignet. Um wieviel mehr ist heute im wiedervereinigten Deutschland Skepsis angebracht gegenüber seinem Plädoyer für den apolitischen Untertan, der sich aus öffentlichen Angelegenheiten und Staatsgeschäften heraushalten soll.
Rothe wehrt sich mithin vehement gegen die derzeit um sich greifende Vereinnahmung des Weimarer Dichterfürsten für nationale und kulturpolitische Zwecke. Die Größe und Einzigartigkeit des Dichters, Dramatikers und Romanciers steht dabei für ihn außer jedem Zweifel.
Wolfgang Rothe setzt sich aus einer bewundernswert umfassenden Kenntnis des Gesamtwerks heraus mit Goethes politischem Kontext auseinander. Die Befunde sind irritierend, ja desillusionierend: Der Erste Minister des Zwergstaates Sachsen-Weimar-Eisenach eignet sich schwerlich als Leitgestirn einer deutschen Republik. Aus Dichtungen, Briefen, Tagebüchern und Annalen entsteht das Bild eines erzkonservativen Verteidigers des spätabsolutistischen Fürstentums. Ein Bild, dem reaktionäre Züge nicht fehlen und das in völligem Widerspruch zu der seit Thomas Mann beliebten Stilisierung Goethes zum »Repräsentanten des bürgerlichen Zeitalters« steht.
Mit seinen kraß antiliberalen Affekten, seiner Abneigung gegen eine Verfassung, seinem Nein zu Presse- und Druckfreiheit und seiner abgrundtiefen Verachtung der »Menge« war der Geheime Rat v. Goethe schon im Vormärz als Integrationsfigur der »verspäteten Nation« ungeeignet. Um wieviel mehr ist heute im wiedervereinigten Deutschland Skepsis angebracht gegenüber seinem Plädoyer für den apolitischen Untertan, der sich aus öffentlichen Angelegenheiten und Staatsgeschäften heraushalten soll.
Rothe wehrt sich mithin vehement gegen die derzeit um sich greifende Vereinnahmung des Weimarer Dichterfürsten für nationale und kulturpolitische Zwecke. Die Größe und Einzigartigkeit des Dichters, Dramatikers und Romanciers steht dabei für ihn außer jedem Zweifel.