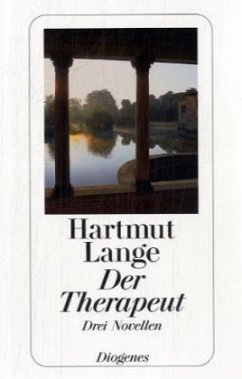Die Untiefen der Existenz: Drei neue Novellen des großen Einzelgängers Hartmut Lange
"Wir können nicht alles, was wahr ist, wirklich sehen, und nicht alles, was wir gesehen haben, können wir der Wahrheit zurechnen." Das ist so ein typischer, vergrübelter Hartmut-Lange-Satz. Er könnte im "Tagebuch eines Melancholikers" stehen, diesem gedankenreichen Bekenntnisbuch aus den Achtzigern mit dem schönen Titel "Deutsche Empfindungen". Doch Lange legt diesen Satz in "Der Hundekehlesee", der ersten seiner drei neuen Novellen, dem Philosophen Wernigerode in den Mund. Dieser See gehört zu den stillen, etwas abgelegenen Gewässern Berlins, sehr geeignet für Geheimnisse. Und an denen lässt uns Hartmut Lange mit sich steigernder Spannung teilnehmen.
In einem Kriminalfilm hieße die banale Frage: Hat Wernigerode seine Geliebte Alima unwissentlich in den Tod im Wasser getrieben, war es womöglich der rachsüchtige jüngere Bruder, oder lebt die morgenländische Schöne versteckt und wider ihren Willen im Schoß ihrer tunesischen Familie? Der Philosoph hat sie dort vergeblich gesucht. Lange belässt es bei vagen Indizien und beunruhigenden Vermutungen. "Grundsätzlich gesehen", lässt er Wernigerode vor seinen Studenten dozieren, "hat der moderne Mensch kaum noch etwas, woran er sich halten kann, und nicht in der Wahrheit, sondern in der Täuschung werden die Untiefen seiner Existenz wirklich berührt." Es gibt hier keine eindeutigen Antworten. Wernigerode taucht wieder in seinen Alltag ein, spielt den ersten Satz der G-Dur-Sonate von Schubert und blättert im Koran, was er, als Alima noch bei ihm war, versäumt hat.
Auch in der zweiten, der titelgebenden Novelle "Der Therapeut" ist Wasser, bleigrau und nebelverhangen, der Unheil verheißende Hintergrund des rätselhaften Geschehens. Der Ich-Erzähler schreibt für eine Zeitschrift über kunstvoll verwilderte Gärten und Parks, während sein Freund die entsprechenden Fotos macht. Ein Anwesen am Halensee verspricht den idealen Stoff für diese Auftragsserie zu liefern: Riesige Rhododendren, eine zerbrochene Bronzeschale, eine armlose efeuumrankte Büste im Stil der Jahrhundertwende, ein Pavillon am See - was sich dem Auge verwahrlost und verlassen bietet, bekommt durch den geheimnisvollen Therapeuten, der in der alten Villa seine Praxis hat, eine geheimnisvolle Bedeutung. Wie der Fotograf in Antonionis Film "Blow up" glaubt der Erzähler einem Verbrechen auf der Spur zu sein. Und obwohl er dazwischen wie verabredet seine Beiträge über italienische Gärten abliefert, lässt ihn das verwunschene Anwesen am Halensee nicht los. War oder ist es der Schauplatz verbotener Sterbehilfe für Lebensmüde, die der Therapeut leistet? Hartmut Lange versteht es, die Spannung bis zum ungewissen Ende durchzuhalten.
Der Rand der Realität und der Tod beschäftigen den inzwischen Siebzigjährigen schon lange. In einer an Kleist geschulten melodischen Sprache kommt er der unterdrückten Angst vor dem Leben nahe wie kein anderer zeitgenössischer Dichter. Auf den verschlungenen Wegen der Philosophie von Hegel über Nietzsche, Schopenhauer zu den Existentialisten versucht er seinen eigenen Weg zu finden. Kein Wunder, dass er nach seiner Übersiedlung in den Westen in den frühen Sechzigern ein Einzelgänger geblieben ist. Vom Literaturbetrieb hat er sich immer ferngehalten. Wenn er dazu aufgefordert wurde, hat er ihn scharfzüngig und unerbittlich kritisiert. "Die Revolution als Geisterschiff", die Sammlung seiner Essays und Kritiken, ist noch heute lesenswert. Dass Kunst sich einen eigenen Wahrheitsgrund schafft, ist Hartmut Langes Resümee und möglicherweise auch sein Trost.
MARIA FRISÉ
Hartmut Lange: "Der Therapeut". Drei Novellen. Diogenes Verlag, Zürich 2007. 148 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Fasziniert zeigt sich Maria Frise von diesen Novellen Hartmut Langes. Sie charakterisiert ihn als "großen Einzelgänger", der einen eigenen Weg geht und sich vom Literaturbetieb fern hält. Wie keinem zweiten zeitgenössischen Schriftsteller gelinge es Lange, der "unterdrückten Angst vor dem Leben" nahe zu kommen. Davon ist für sie auch in den vorliegenden Novellen etwas zu spüren, die ihr ebenso geheimnisvoll wie fesselnd erscheinen. Sie hebt hervor, dass der Autor dabei keineswegs die typischen Mittel des Krimis nutzt, um Spannung zu erzeugen. So bleibe es in der Geschichte "Der Hundekehlesee", in der die Geliebte des Philosophen Wernigerode verschwindet, etwa bei Andeutungen und Indizien, die eine beunruhigende Atmosphäre erzeugen. Besonders gefallen hat Frise auch die "melodische" Sprache, die sie an Kleist erinnert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Der Meister unter den phantastischen Rationalisten.« Edelgard Abenstein / Deutschlandradio Kultur Deutschlandradio Kultur