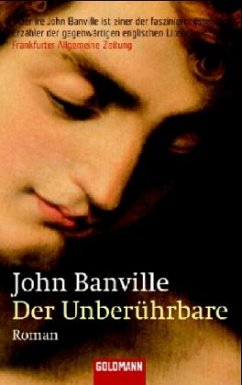Sprachgewaltiger Nicht-Thriller
In seinem Roman «Der Unberührbare» erzählt der irische Schriftsteller John Banville die Lebensgeschichte eines Spions und Doppelagenten, der am Ende seiner konspirativen Karriere auffliegt und ins Bodenlose stürzt. Victor Maskell, Sohn eines protestantischen
Bischoffs, als promovierter Kunsthistoriker hoch angesehen, Kurator der königlichen Kunstsammlungen mit…mehrSprachgewaltiger Nicht-Thriller
In seinem Roman «Der Unberührbare» erzählt der irische Schriftsteller John Banville die Lebensgeschichte eines Spions und Doppelagenten, der am Ende seiner konspirativen Karriere auffliegt und ins Bodenlose stürzt. Victor Maskell, Sohn eines protestantischen Bischoffs, als promovierter Kunsthistoriker hoch angesehen, Kurator der königlichen Kunstsammlungen mit verwandtschaftlichen Verbindungen zu den Windsors, wird nach seiner Enttarnung von einer jungen Frau aufgesucht, die ein Buch über ihn schreiben will. Der 72Jährige hält den Inhalt ihrer Gespräche schriftlich fest und schreibt damit quasi nebenbei seine Autobiografie, er rekapituliert als plötzlich geächteter und vereinsamter Mann der britischen Oberklasse sein bewegtes Leben. Darin hat er viele Rollen gespielt, ohne je wirklich Empathie entwickelt zu haben, selbst nicht seiner Frau und seinen Kindern gegenüber. Er hat nichts und niemanden an sich heran gelassen, er war stets «Der Unberührbare». Trotz seiner Thematik ist dieser Roman allerdings alles andere als ein Spionagethriller, soviel vorweg!
Der Schwerpunkt der nicht chronologisch angelegten Erzählung liegt im London Ende der wilden ‹Dreißiger Jahre›, wo der Ich-Erzähler als Mitglied der ‹Guten Gesellschaft› ein Leben in Saus und Braus führt. Als Kunstexperte hat Victor Maskell sich einer intellektuellen Szene angeschlossen, in der wilde Diskussionen auch über politische Themen geführt werden. Die kleine Clique, der er angehört, hält den Kommunismus für die bessere Gesellschaftsform und beginnt, dem russischen Geheimdienst Informationen zu liefern und britische Behörden und Institutionen auszukundschaften. Dabei bleibt der Protagonist auffallend distanziert, für ihn ist die Spionage lediglich eine Möglichkeit, etwas Leben in seinen langweiligen Alltag als Wissenschaftler zu bringen. Seine introvertierte Art hilft ihm dabei, später auch als Doppelagent viele Kontakte zu beiden Seiten zu halten, ohne dabei aufzufallen.
Auch privat ist er ein Einzelgänger, der erst spät, als über Zwanzigjähriger, die Schwester seines besten Freundes spontan nachts anruft und sie fragt: «Wollen Sie meine Frau werden?» Nach kurzer Bedenkzeit stimmt Vivienne zu. Er erlebt nach der Hochzeit seine Initiation, denn er hatte bisher noch nie Kontakt zu einer Frau. Aber Vivienne hilft ihm lachend über seine Unbeholfenheit hinweg, sie hatte schon etliche Liebhaber. Seine bisher unterdrückte, latente Homosexualität kommt dann allerdings später umso stärker zum Vorschein. Als Schwuler führt er ein geheimes Leben in den entsprechenden Kreisen, das streng geheim bleiben muss, um ihn nicht zu kompromittieren. Aber auch dabei bleibt er rigoros egoistisch, ohne enge und dauerhafte Bindungen einzugehen. Einzig die Kunst, und dabei speziell der französische Barockmaler Nicolas Poussin, berührt ihn wirklich, ist Balsam für seine Seele.
John Banville zeichnet seinen egoistischen Protagonisten als unberechenbar und kaltherzig, wenn er ihn detailreich davon erzählen lässt, wie er zum Spion wurde. In unendlich vielen, alkohollastigen Gesprächen der unnahbaren Hauptfigur erläutert der Autor kenntnisreich die vielen Querverbindungen und Kontakte der Akteure, die ein dichtes Spionagenetz bilden, in dem kaum noch einer den Durchblick hat, selbst die obersten Chargen nicht. Aber so viel da auch erzählt wird, so wenig erfährt der Leser letztendlich wirklich, alles bleibt im Dunstkreis der Geheimagenten und ihrer chiffrierten Sprache. Sein Held, der als kunstbesessen so gar nicht in die eher profane, politische Welt jener Zeit von vor bis nach dem Zweiten Weltkrieg passt, bleibt auch im Verhältnis zum Leser «unberührbar», er ist und bleibt in seiner emotionslosen Art eine zutiefst unsympathische Figur. So wenig also der Plot selbst zu bieten hat, so kontemplativ ist die Art des Erzählens, stilistisch ein Fest geradezu an intellektuellen Gedankengängen. Die alle nachvollziehen zu können fordert volle Aufmerksamkeit, wirkt anschließend dann aber auch sehr bereichend in seiner imponierenden Sprachgewalt.