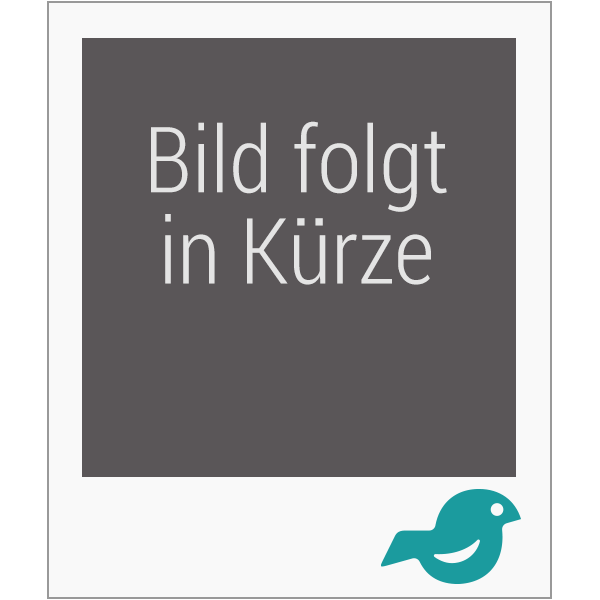Kriege enden nicht mit dem letzten Schuß. Das gilt besonders für den Ersten Weltkrieg. Waffenstillstand und Friedensschluss bilden nur äußere Eckpunkte. Die Kriegserfahrung setzte sich in vielfältiger und häufig gebrochener Form in der Nachkriegszeit fort. Trauer und Verlust, Kriegsangst und Kriegsbegeisterung gab es auch in der Zeit danach.
Dieser Band geht der mentalen Verarbeitung des "Großen Krieges" bei Siegern und Besiegten ebenso nach, wie er die kurz- und langfristigen Verwerfungen, aber auch Instrumentalisierungen dieser Erfahrung zum Thema macht. Regionale Zusammenhänge ermöglichen eine Nachbetrachtung wie auch der Blick auf einzelne soziale Gruppen - von den Pazifisten bis zu den nationalen Frauenverbänden. Die Verlängerung des "Krieges in den Köpfen" und die Auswirkungen auf die Lebensumstände der Menschen werden an Personen sowie an symbolischen und ästhetischen Formen der Erinnerung aufgezeigt. So entsteht ein breites Panorama über den "Nachkrieg" des Ersten Weltkriegs, das gleichermaßen die deutsche Geschichte wie international vergleichende Aspekte umfaßt.
Dieser Band geht der mentalen Verarbeitung des "Großen Krieges" bei Siegern und Besiegten ebenso nach, wie er die kurz- und langfristigen Verwerfungen, aber auch Instrumentalisierungen dieser Erfahrung zum Thema macht. Regionale Zusammenhänge ermöglichen eine Nachbetrachtung wie auch der Blick auf einzelne soziale Gruppen - von den Pazifisten bis zu den nationalen Frauenverbänden. Die Verlängerung des "Krieges in den Köpfen" und die Auswirkungen auf die Lebensumstände der Menschen werden an Personen sowie an symbolischen und ästhetischen Formen der Erinnerung aufgezeigt. So entsteht ein breites Panorama über den "Nachkrieg" des Ersten Weltkriegs, das gleichermaßen die deutsche Geschichte wie international vergleichende Aspekte umfaßt.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Einen neuen Kalten Krieg sieht Rezensent Gustav Seibt nach Lektüre dieses Buches aufziehen. Andreas Rödders Analyse nimmt ihren Ausgangspunkt, rekonstruiert Seibt, 1990 mit dem Ende des ersten Kalten Krieges und der Hoffnung auf ein Ende der Geschichte. In der Folge, so die Zusammenfassung, implodiert der ehemalige Ostblock, während der Westen expandiert, allerdings in der Ukraine und in Georgien keine Fakten schafft, sondern ein Machtvakuum bestehen lässt. In den Blick geraten in dieser Analyse, beschreibt Seibt, die hierzulande oft übersehenen Perspektiven osteuropäischer Länder, die aus guten Gründen vor Putin Angst haben. Zum Wendepunkt wird die Finanzkrise 2008, lernt Seibt außerdem von Rödder, danach erkennen Russland und China, dass der Westen, dessen Handeln sie als Demütigung empfinden, seinerseits schwach ist. Wie nun auf diese Situation reagieren, fragt sich Rödder Seibt zufolge und greift auf die Idee eines wehrhaften Liberalismus zurück. Der Westen soll seine Außengrenzen verteidigen, liest Seibt, nach innen soll er Freiheitsrechte wahren, aber wachsam sein gegenüber Putinpropaganda, wie auch gegen Umtriebe der Marke links-woke. Mit letzterer Wendung ist Seibt nicht allzu glücklich, da bricht in Rödder der konservative CDU-Mann durch, findet er. Auch die Frage, wie es um die Freiheitsrechte der Menschen im neuen Block des Autoritarismus, dessen ideologische Selbstbeschreibung der Autor durchaus ernst nimmt, bestellt ist, bleibt letztlich offen, findet der Rezensent. Insgesamt jedoch beschreibt Seibt Rödders Buch als eine anregende Lektüre über die nichterfüllten geopolitischen Hoffnungen der jüngeren Vergangenheit.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH