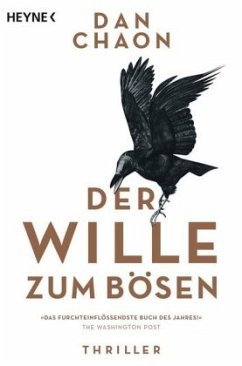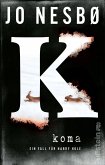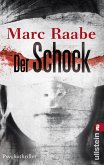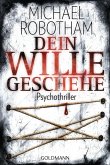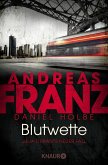Meine Highlight-Liste 2018 hat Zuwachs bekommen: „Der Wille zum Bösen“ des amerikanischen Autors Dan Chaon, ein ungewöhnlicher und faszinierender Thiller(Platz 2 und höchster Neueinsteiger der Krimibestenliste Juni 2018), bei dem die Frage „Wer war’s?“ allein durch die Form komplett in den
Hintergrund gedrängt wird.
Worum geht es? Diese Frage ist schnell beantwortet: nach 27 Jahren Haft wird…mehrMeine Highlight-Liste 2018 hat Zuwachs bekommen: „Der Wille zum Bösen“ des amerikanischen Autors Dan Chaon, ein ungewöhnlicher und faszinierender Thiller(Platz 2 und höchster Neueinsteiger der Krimibestenliste Juni 2018), bei dem die Frage „Wer war’s?“ allein durch die Form komplett in den Hintergrund gedrängt wird.
Worum geht es? Diese Frage ist schnell beantwortet: nach 27 Jahren Haft wird Russell, der Adoptivbruder des Psychologen Dustin Tillman, aus der Haft entlassen, nachdem DNA-Analysen seine Unschuld am gewaltsamen Tod der Eltern ergeben haben. Dustin war von dessen Schuld überzeugt und hatte im Prozess als Belastungszeuge ausgesagt. Annähernd gleichzeitig fordert Aqil, ehemalige Polizist und einer seiner Patienten, seine Mithilfe im Fall eines Serienmörders, der an bestimmten Daten junge Männer in abgelegenen Gewässern ertränkt. Wer hat die Tillman-Eltern getötet, und gibt es den Serienkiller wirklich? Das sind die beiden Fragen, die Dustin umtreiben und sein durchschnittliches Leben komplett aus den Fugen geraten lassen.
Die Story hört sich nun nicht wirklich spektakulär an. So oder so ähnlich hat man das schon zigmal gelesen. Was aber nun Chaon daraus macht ist außergewöhnlich. Nicht nur, dass er seine Leser auf eine Reise in die Vergangenheit schickt, kennt man ja auch zur Genüge, nein, da hat er wesentlich mehr auf Lager.
Dustin, seine beiden Söhne Aaron und Dennis, seine an Krebs gestorbene Frau, die beiden Cousinen Kate und Wave und natürlich Russell „Rusty“, jeder von ihnen hat seine eigene Stimme und seine individuelle Sicht auf die Ereignisse, wobei Chaon diese unterschiedlichen Reflexionen willkürlich zwischen den verschiedenen Personen und Zeiten, nämlich Herbst 1983 und Frühjahr 2014 hin und her springen lässt. Und dann gibt es noch bestimmte Situationen, in denen er parallel erzählt, die Sichtweisen verschiedener Personen auf das gleiche Ereignis in parallelen Spalten anordnet, die sich teilweise über mehrere Spalten und Seiten ziehen, was den Leser verunsichern und schlussendlich dazu zwingen mag, seine Annahmen zu hinterfragen.
Was alle Figuren eint, ist dieses Gefühl der Einsamkeit, des Verlorenseins. Und jeder von ihnen hat seine eigene Methode entwickelt, damit umzugehen. Die einen flüchten sich in Drogen, die anderen in die Spiritualität, die nächsten versuchen ihren Platz in der Normalität zu finden. Es gelingt, oder auch nicht. Und am Ende zeigt sich, dass auch die individuelle Realität nur eine verstörende Form der Fiktion ist. Lesen!