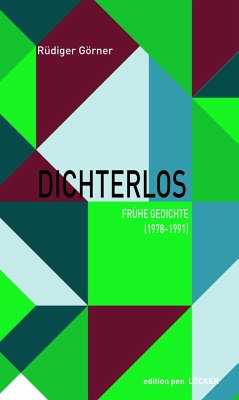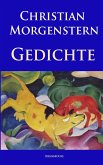Ode des Blinden Drüben raunen die Chöre der Seher: ihre Zehen tasten die Furchen ab, zerstampfen aber die erdwarmen Früchte. Worte wippen auf seiner Zunge, er fühlt die Nähe eines Satzes. Irislose weiße Äpfel in den Schädelhöhlen. Keinem steht das Gesehene zu Gesicht. Zuckende Worte wie schwengellose Glocken im Turm über der Grotte; Vergib dieser Stunde, denn sie weiß nicht, was sie schlägt. Blindschleichen schieben sich vor Zwischen die Füße, zwischen die Leiber. Schemen huschen durch den Milchdunst. Er wühlt in der Asche der Stille und bläst in den Korb voller Münder. Bald brennt die Dunkelheit.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Harald Hartung wundert sich nur kurz über den etwas antiquierten Titel und die Entstehungszeit dieser Gedichte von Rüdiger Görner. Dass der Autor Texte aus den Jahren 1978 bis 1991 publiziert, geht für ihn in Ordnung. Zeitlos scheinen ihm die Gedichte über "Kollegen" wie Hölderlin und Kafka oder "Dichter-Orte" wie Dublin und Rodaun. Überzeugend findet er Görner nicht zuletzt, weil sich in dessen Bewunderung für das Dichterschicksal immer auch ein gewisser Pessimismus mischt und der Autor witzig das Vergebliche aller Poeterei benennt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH