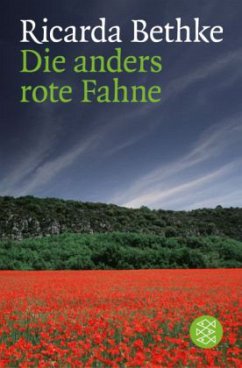In einer Kleinstadt an der Saale erlebt die kleine Candida das Ende des Zweiten Weltkriegs und die ersten Jahre der DDR mit dem zugleich träumerischen wie klarsichtigen Blick des Kindes, der bis in die feinsten Verästelungen des Alltags zu sehen vermag. Diesen Blick, der sich mit staunender Neugier vor allem auf den unmittelbaren Umkreis und das eigene Innere richtet, behält sie auch, als sie Jahre später zum Studium nach Berlin kommt. Unter den offiziell nicht anerkannten, von Armut und politischem Druck bedrohten Künstlern im Osten Berlins, träumt sie von einem anderen Sozialismus - und von Hans,dem Maler ohne Aufträge.
Ricarda Bethkes autobiographischer Roman über ihr Aufwachsen in der thüringischen Provinz der 40er und 50er Jahre und ihr Leben im Berlin der 60er stellt nicht die großen politisch-historischen Ereignisse dieser Zeit in den Mittelpunkt, sondern die persönlichen Glücksmomente und Unglücksfälle eines Lebens. Entstanden ist ein Buch der detaillierten, poetisch verzauber ten Erinnerung: Eine Familien- und Generationengeschichte, in der sich die Tochter der anderen Lebensentwürfe von Mutter und Großmutter versichern muss, um ihren eigenen Weg finden zu können.
Ricarda Bethkes autobiographischer Roman über ihr Aufwachsen in der thüringischen Provinz der 40er und 50er Jahre und ihr Leben im Berlin der 60er stellt nicht die großen politisch-historischen Ereignisse dieser Zeit in den Mittelpunkt, sondern die persönlichen Glücksmomente und Unglücksfälle eines Lebens. Entstanden ist ein Buch der detaillierten, poetisch verzauber ten Erinnerung: Eine Familien- und Generationengeschichte, in der sich die Tochter der anderen Lebensentwürfe von Mutter und Großmutter versichern muss, um ihren eigenen Weg finden zu können.

Leerstelle Politik: Ricarda Bethkes Roman "Die anders rote Fahne"
Autoren, die vor dem Fall der Mauer die DDR verließen, haben es leichter, ihre Autobiographie zu schreiben, als jene, die den "Republikflüchtigen" aus ihrem Verwandten- und Freundeskreis nicht folgten und heute leicht unter Erklärungs- oder Rechtfertigungszwang geraten. Der Erwartungsdruck kann ernste Reflexion, Bekenntniseifer oder Bußfertigkeit, andererseits trotziges Beharren auslösen. Doch kann auch die Identitätsfrage ausgeklammert bleiben. Ebendas geschieht in Ricarda Bethkes autobiographischem Roman "Die anders rote Fahne".
Die Autorin, 1939 in Berlin geboren und in Thüringen aufgewachsen, war Lehrerin für "Deutsch" und "Kunst" und arbeitet als Schriftstellerin seit 1984 vor allem für den Rundfunk. Das autobiographische Ich tarnt sich in dem Roman unter dem Namen Candida. Die rote Fahne, die der Großvater Candidas 1945 beim Einmarsch der Russen in die thüringische Kleinstadt aus dem Versteck hervorholt, ist die "andere", weil sie die rote Fahne mit dem schwarzen Hakenkreuz auf weißem Grund ablöst. Der Großvater wird Parteisekretär, die Familie bekennt sich zum Kommunismus. Was das genauer heißt, wird nicht gesagt. Denn das Erzähler-Ich hält sich zunächst an die Perspektive und den Denkhorizont des damals fünfjährigen Mädchens, das von der Mutter allein erzogen wird (der Vater, Badearzt, hat sich im Krieg der drohenden Verhaftung durch Selbstmord entzogen).
Die Begrenzung des Beobachtungswinkels hat erzählerische Vorzüge, weil sie die Naivität der Kindheitserlebnisse bewahrt. Lange hält die Erzählerin an dieser Kindperspektive fest, und etwas von der frischen Wahrnehmung bleibt erhalten und kennzeichnet den Roman überhaupt. Es ist dies eine Gabe der genauen Wahrnehmung sinnlicher Erscheinungen, aus der sich auch das später entdeckte Zeichen- und Maltalent Candidas erklärt.
Den Großmüttern fällt in Kindheitberichten oft die Rolle der Märchenerzählerin zu. Candidas Großmutter, proletarischer Herkunft, ist aus anderem Holz, sie liest mit Vorliebe Dramen Shakespeares. Die Enkelin beschreibt sie genauer, als sie ihr eines Tages im Bad den Rücken rubbeln muß: "Im Gesicht ist sie leicht gerötet, die Hände und Unterarme sind bräunlich und pergamenten. Die Rückseiten der Oberarme sind wabbelig grauweiß. Die Brüste und die Schenkel haben durchsichtige Haut mit blauen Adern. Der Bauch schiebt sich als ein beuliger Klumpen hoch. Seine Farbe ist mehr talkig, hellgelb. An den Beinen gibt es große braune Flecken von Verbrennungen, Stößen und Wunden." Das ist mit den Augen einer Malerin gesehen.
Mit solchen Augen bewegt sich die Erzählerin durch die Straßen und die Umgebung des thüringischen Städtchens, vorbei an der immer etwas unheimlichen Mauer, die das Kasernengelände der russischen Armee umgibt. Das nach dem Auge stärkste Sinnesorgan ist das Riechorgan. Krankheiten werden am Geruch identifiziert, schon beim Eintreten ins Haus wird die Nase vom Duft der Kochwäsche oder der Gerichte empfangen, am Bahnhof vom Geruch der Wurstsuppe und des Urins. Die Jugendweltfestspiele in Berlin werden dem Mädchen verleidet durch den Chlorgeruch im Pionier-Zeltlager Wuhlheide. Als Candida später in Berlin studiert, steigen "aus allen Ritzen" die Gerüche der Nachkriegszeit auf.
Ricarda Bethke schreibt eine realitätsnahe Prosa, deren Repertoire sich in demselben Maße erweitert wie der Erfahrungsraum des Erzähler-Ichs. Das Leben im Berliner Studentenheim, die Zeichen- und Malstunden bei den Professoren, die Pflichtarbeit in der Fabrik und beim Ernteeinsatz, nach dem Studium der Schulunterricht in einer Provinzstadt, die Besuche in Berlin und die Begegnung mit "nicht staatskonformen" Künstlern und Intellektuellen - alles dies rundet sich zu einer Biographie, die ganz im Widerschein des Lebens in der DDR steht.
Candida leidet unter ihrem Mangel an Selbstsicherheit, sie hält sich für unattraktiv, hadert mit ihrer langen, hageren Gestalt und ihrer Flachbrüstigkeit, kurz, sie ist, wie es heißt, "nicht so richtig auf dem Liebesmarkt". Hinter dieser Selbstironie verbirgt sich eine dauerhafte Enttäuschung. Der Student Alexander erwidert ihre Liebe nicht. Sie flieht in eine kurze Bettgeschichte mit einem Elektromonteur, die zum Fehlschlag wird. Am Ende lebt sie mit dem Künstler Hans zusammen, den sie liebt, der aber seinerseits nicht loskommt von einem Gretchen, das ihn verlassen hat. Es geht ein wenig zu wie in den alten Liedern, über die Candida ihre germanistische Seminararbeit "Das Mädchenschicksal in der deutschen Volksballade" geschrieben hat.
Zum melancholischen Ende des Romans paßt Candidas Eingeständnis der "Illusion von der richtigen roten Fahne". Doch steht solche Selbstprüfung zu isoliert im Ganzen des Romans. So ausgiebig uns die Erzählerin mit der Landschaft und mit der Stadt, mit der Familie und den Freunden, mit den Studenten- und dem Schulalltag und auch mit ihren schmerzlichen Liebeserfahrungen vertraut macht, so wenig teilt sie über ihre innere und individuelle Auseinandersetzung mit der politischen Wirklichkeit der DDR mit. Das Ungenügen des Lesers entspringt keinem inquisitorischen Interesse. Aber wo der Lebenslauf einer zur "Intelligenz" zählenden DDR-Bürgerin präzise erzählt wird, darf man auch ein gewisses Maß an politischer Reflexion erwarten. Aber in diesem Punkt sieht sich die Ich-Erzählerin ganz von außen, gewährt uns keinen Einblick in ihren Kopf.
Als Stalin gestorben ist, zeigen die Medien weinende Menschen, schreiben Dichter pathetische Nachrufe. Welche Empfindungen bewegen die immerhin schon dreizehnjährige Candida? Man erfährt nur von den Reaktionen anderer. Wie hat Chruschtschows Enthüllung, die Enttarnung Stalins auf die junge Kommunistin gewirkt? Als die Berliner Mauer gebaut wird, trauert Candida um die gestorbene Großmutter. Dennoch überrascht der lapidare Kommentar: "Es ist mir egal. Ich will sowieso nicht in den Westen." Candida hört gelegentlich den Westsender RIAS, sieht das Westfernsehen - bringt sie das in einen Zwiespalt, eine Bewußtseinsspaltung? Melden sich nie Zweifel? Die Erzählerin läßt sich auf solche Fragen nicht ein. So bleibt eine Leerstelle im Roman.
WALTER HINCK.
Ricarda Bethke: "Die anders rote Fahne". S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2001. 284 S., geb., 39,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main