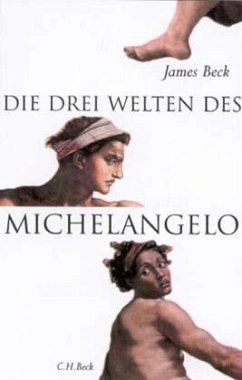Michelangelos Weg zur Meisterschaft
In diesem Buch macht sich ein wissenschaftlicher Detektiv an die Arbeit. Er geht den Hunderten von Hinweisen in zeitgenössischen Dokumenten nach und entwirft ein neues Bild Michelangelos, das die Jahre der frühen Meisterschaft bis zur Vollendung der monumentalen Deckenmalerei in der Sixtinischen Kapelle (1512) umfaßt. James Beck, ein Kenner der Renaissance-Kunst, eröffnet hier einen neuen Zugang zu Denken und Fühlen, zu Temperament und Sexualität dieses bereits zu Lebzeiten "göttlich" genannten Künstlers. Der künstlerische Aufstieg Michelangelos begann, als er 26jährig seinen ersten Auftrag für eine Monumentalstatue übernahm, die zugleich eine seiner berühmtesten werden sollte: der marmorne David, ein Meisterwerk von klassischem Ebenmaß, das bis 1873 vor dem Florentiner Palazzo Vecchio stand. Zwei Männer haben diese erste Lebensphase geprägt: Lodovico, der strenge Vater, und Lorenzo de Medici - "il magnifico" -, der autokratische und kunstliebende Stadtherr von Florenz.
Beinahe 30jährig knüpfte Michelangelo die entscheidende dritte Verbindung - zu dem neugewählten Julius II. Dem Auftrag für das Grabmal dieses eigenwilligen und unberechenbaren Papstes verdanken wir Meisterwerke wie die Sklaven und den Moses. Am Ende dieser genialen Jugendphase steht Michelangelos Vollendung der riesigen Deckenfresken in der Sixtinischen Kapelle im Jahr 1512.
Gestützt auf zahlreiche, weitgehend noch zu Lebzeiten des Künstlers entstandene Dokumente entwirft James Beck eine sehr dichte Biograp hie der frühen Jahre. Dabei scheut er sich nicht, neben den künstlerischen auch die prägenden persönlichen Einflüsse, Begegnungen, Gedanken und Empfindungen zu benennen und zu einem überraschend frischen Lebensbild zusammenzufügen.
In diesem Buch macht sich ein wissenschaftlicher Detektiv an die Arbeit. Er geht den Hunderten von Hinweisen in zeitgenössischen Dokumenten nach und entwirft ein neues Bild Michelangelos, das die Jahre der frühen Meisterschaft bis zur Vollendung der monumentalen Deckenmalerei in der Sixtinischen Kapelle (1512) umfaßt. James Beck, ein Kenner der Renaissance-Kunst, eröffnet hier einen neuen Zugang zu Denken und Fühlen, zu Temperament und Sexualität dieses bereits zu Lebzeiten "göttlich" genannten Künstlers. Der künstlerische Aufstieg Michelangelos begann, als er 26jährig seinen ersten Auftrag für eine Monumentalstatue übernahm, die zugleich eine seiner berühmtesten werden sollte: der marmorne David, ein Meisterwerk von klassischem Ebenmaß, das bis 1873 vor dem Florentiner Palazzo Vecchio stand. Zwei Männer haben diese erste Lebensphase geprägt: Lodovico, der strenge Vater, und Lorenzo de Medici - "il magnifico" -, der autokratische und kunstliebende Stadtherr von Florenz.
Beinahe 30jährig knüpfte Michelangelo die entscheidende dritte Verbindung - zu dem neugewählten Julius II. Dem Auftrag für das Grabmal dieses eigenwilligen und unberechenbaren Papstes verdanken wir Meisterwerke wie die Sklaven und den Moses. Am Ende dieser genialen Jugendphase steht Michelangelos Vollendung der riesigen Deckenfresken in der Sixtinischen Kapelle im Jahr 1512.
Gestützt auf zahlreiche, weitgehend noch zu Lebzeiten des Künstlers entstandene Dokumente entwirft James Beck eine sehr dichte Biograp hie der frühen Jahre. Dabei scheut er sich nicht, neben den künstlerischen auch die prägenden persönlichen Einflüsse, Begegnungen, Gedanken und Empfindungen zu benennen und zu einem überraschend frischen Lebensbild zusammenzufügen.

Quellensteuerfrei: James H. Beck weiß, was Michelangelo so wenig umgetrieben hat / Von Wilfried Wiegand
Der uns allen vertraute Typ der kunsthistorischen Monographie ist keine hundert Jahre alt. Heinrich Wölfflin war der erste Kunstschriftsteller, der den entscheidenden Schritt wagte und die Werkanalyse von der bis dahin vorherrschenden Lebensbeschreibung trennte. Sein Dürer-Buch von 1905 beginnt mit einer auf sechzehn Seiten zusammengedrängten Biographie, die folgenden dreihundert Seiten sind dann nur noch den Kunstwerken gewidmet. Wölfflins Buch wird mit Recht als ein Gründerwerk wissenschaftlicher Kunstanalyse gefeiert, und alle großen Autoren haben sich bis heute mehr oder weniger an sein Vorbild gehalten. Je mehr wir aber gelernt haben, auch wissenschaftliche Literatur historisch wahrzunehmen, je mehr unser Sinn sich geschärft hat für die Klassiker-Qualität der großen Kunsthistoriker, um so deutlicher wird zugleich, wie verhängnisvoll Wölfflins Versachlichung die Kunstwissenschaft vom großen literarischen Publikum isoliert hat.
Sie war nun zwar frei von Kitsch und Kolportage, aber leider ebenso frei von allen Kontakten mit dem allgemeinen Entwicklungsgang der Literatur. Daß einige geniale Autoren wie Roberto Longhi oder Henri Focillon, Erwin Panofsky oder André Chastel auch nach Wölfflin immer wieder große literarische Leistungen zustande brachten, widerspricht nicht der traurigen Tatsache, daß Literatur und Kunstwissenschaft seit Wölfflin prinzipiell zweierlei geworden sind. Von Giorgio Vasari bis Carl Justi und Hermann Grimm war die Künstlerbiographie ganz selbstverständlich eine Gattung der Literatur gewesen. Ihre Rhetorik war die gleiche wie die von Anekdote, Novelle und Roman, und selbstverständlich richtete sie sich an das gleiche Publikum. Seit Wölflin aber überläßt die Kunstwissenschaft das biographische Genre den Amateuren.
Doch immer wieder gibt es auch Wissenschaftler, die aus dem Getto der drögen Begrifflichkeit ausbrechen wollen. Das muß keineswegs heißen, daß dabei alles Expertenwissen über Bord geworfen wird. Im Gegenteil, besonders von amerikanischen Akademikern wird in den letzten Jahren immer wieder der Versuch gemacht, die in hundert Jahren aufgehäuften Forschungserträge in eine leserfreundliche, vorwiegend biographische Erzählform zu bringen. Und sind nicht die verfeinerten Methoden der Moderne, allen voran die Psychoanalyse, bei der Verknüpfung von Werkanalyse und Lebensgeschichte ebenso hilfreich, wie es für Grimm und Justi die historische Allgemeinbildung war?
Der bisher jüngste Versuch, das abgewanderte Lesepublikum durch die biographische Darstellungsform zurückzuerobern, stammt von James H. Beck, Professor für Kunstgeschichte an der Columbia University, New York. Beck ist Experte für die italienische Renaissance und noch in Erinnerung durch seine überzogene Polemik gegen die Restaurierung der Sixtinischen Kapelle, die in den späten achtziger und frühen neunziger Jahren Schlagzeilen machte. Sein neues Buch konzentriert sich auf die erste Hälfte von Michelangelos langem Leben (1475 bis 1569). Es endet, abgesehen von einem Ausblick auf Michelangelos letztes Werk, die "Pietà Rondanini", mit dem Jahr 1513, als Papst Julius II., sein größter Auftraggeber, stirbt. Das ist, um die Biographie abzubrechen, in der Tat kein schlechtes Datum. Michelangelo hat damals seine weltbekannten Hauptwerke schon geschaffen oder zumindest konzipiert: Der riesige David steht schon seit neun Jahren in Florenz, die Sixtinische Decke ist fertig, und das überdimensionale, niemals vollendete Julius-Grabmal ist als Ganzes skizziert und in einzelnen schon angefangen.
Aber warum überhaupt will Beck seine Biographie so früh schon beenden? Eine merkwürdige Idee hat ihn dazu verführt. Beck ist der Überzeugung, daß Michelangelos Entwicklung - biographisch und künstlerisch - sich durch drei "Väter" erklären läßt: den leiblichen Vater, dann seinen ersten Mäzen Cosimo Medici, schließlich den furchteinflößenden Auftraggeber Julius II. Dieser Ansatz hat zur Folge, daß der Autor viel kulturgeschichtlichen Aufwand treibt, am Schluß aber nur Deutungen anzubieten hat, die mit ein paar entschlossenen psychoanalytischen Konklusionen schneller zu haben gewesen wären. Vage wird eine lebenslange Bewunderung für seinen ersten Mäzen Lorenzo Medici, "Il Magnifico", behauptet. Etwas gewaltsam wird die charakterliche Ähnlichkeit mit dem jähzornigen Julius II. konstruiert. Und eine lebenslange Nähe zur eigenen Familie wird als Besonderheit gerade dieses Lebenslaufes mißverstanden.
Beck kennt die Quellen, und sein Verhängnis ist, daß er sie gar zu gut kennt. Ausführlich zitiert er aus dem Briefwechsel mit dem Vater und mit den Brüdern. Was dabei für das Verständnis der Werke herauskommt, ist herzerweichend trivial. Fast überall, besonders aus der "Madonna Doni" und den Fresken der Sixtinischen Decke, meint Beck die Sehnsucht des Einzelgängers nach Heim und Geborgenheit herauszuspüren. Und ist nicht sogar die Pietà Rondanini ein verzweifeltes Werben um die Liebe des Vaters, der seinem Sohn nie so recht verziehen hat, daß er nur den Beruf eines Bildhauers erlernte? Ergreifend ist das Werk gewiß, aber dafür haben wir schon bessere Erklärungen gelesen. Beck will die Menschlichkeit Michelangelos freilegen und wird dabei so platt, daß das Besondere seiner Kunst nicht deutlicher spricht, sondern hinter dem Horizont des Allgemeinen zu verschwinden droht.
Unentwegt wird aus irgendwelchen Quellen zitiert, meist ohne daß etwas dabei herauskommt, was für den Künstler oder sein Werk wichtig wäre. Nur selten ist der kulturgeschichtliche Rohstoff an sich so interessant, daß man ihn mit Interesse um seiner selbst willen liest. In diese Kategorie gehört beispielsweise die Expertendiskussion, die in Florenz, kaum war der David fertig, darum geführt wurde, wo die Statue aufgestellt werden soll. Beck zitiert seitenlang aus dem Protokoll, und man ist ihm dankbar dafür. Endlich einmal fühlt man sich, als säße man in der Zeitmaschine und sei eben im Florenz des späten Quattrocento gelandet.
Das ganze Elend der Quellenhuberei wird sichtbar, wenn Beck sich daranmacht, ausführlich die Frage von Michelangelos Homosexualität zu erörtern. War er nun, oder war er nicht? Becks Antwort ist verblüffend, das muß man ihr lassen. Genaues, so gesteht er nach Lage der Quellen ein, wissen wir sowieso nicht. Aber statt sie nun beiseite zu legen und die Werke zu befragen, zieht er aus dem Schweigen der Dokumente die eigenartige Folgerung, daß Michelangelo vermutlich so gut wie gar kein Sexualleben hatte. Diese Behauptung enthebt den Autor der Notwendigkeit, zur Frage der Homosexualität Stellung zu beziehen. Aber wie kommt Beck überhaupt zu der verblüffenden Ansicht, Michelangelos Geschlechtsleben habe sich vor allem als Keuschheit geäußert?
Die Quellen haben es ihm erzählt. Denn hat der Künstler sich nicht in seinen Briefen lobend über Enthaltsamkeit geäußert? Daß derartige Selbstdarstellungen nicht unbedingt getreue Schilderungen des tatsächlichen Sexualverhaltens sind, weiß, so möchte man meinen, heutzutage jeder, aber offenkundig stimmt das nicht. James H. Beck jedenfalls weiß es nicht. Daß Homosexualität als überaus verwerflich galt und mit grausamen Strafen geahndet wurde, belegt er umständlich mit zeitgenössischen Zitaten. Aber auf die naheliegende Folgerung, daß Michelangelo sich das Image des sexuellen Abstinenzlers zugelegt haben könnte, um eben solchen Diffamierungen und Strafen zu entgehen, kommt Beck keine Sekunde lang. Er nimmt alles, was der Künstler und seine Freunde zu Michelangelos Gunsten sagen, ganz naiv beim Wort. Als Menschenkenner ist James H. Beck, man kann es leider nicht beschönigen, eine runde Null. Was nützt es, alle Quellen zu kennen, wenn man das Leben so gar nicht kennt?
James H. Beck: "Die drei Welten des Michelangelo". Aus dem Englischen von Ulrich Enderwitz, Monika Noll und Rolf Schubert. C. H. Beck Verlag, München 2001. 270 S., 58 Abb., geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Der Rezensent findet hier vieles zu umständlich. Warum der Autor seine Biografie bereits mit dem Jahr 1513 enden lässt, als mit Papst Julius II. Michelangelos größter Auftraggeber stirbt, will Wilfried Wiegand nicht so recht einleuchten, oder jedenfalls nicht mit Hilfe des "kulturgeschichtlichen Aufwands", der hier getrieben wird. Die These von den drei prägenden Vaterfiguren, als deren letzte Julius II. figuriert, die Wiegand hinter dem abrupten Ende vermutet, schreibt er, wäre mit ein paar entschlossenen psychoanalytischen Konklusionen schneller zu konstruieren gewesen. Und dann diese Quellenhuberei! Was dabei für das Verständnis der Werke herauskommt, findet Wiegand nur "herzerweichend trivial". Wirklich nützlich, das Verständnis des Werks wie den Künstler betreffend, so glaubt er, wäre ein Minimum an Menschenkenntnis gewesen. In dieser Hinsicht aber sei der Autor "eine runde Null".
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"