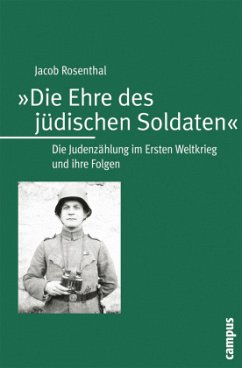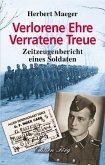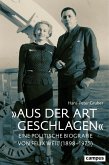Viele Juden meldeten sich im Ersten Weltkrieg freiwillig zum Militär. Doch bald hieß es, es gäbe nur wenig jüdische Soldaten, die noch dazu meist in der Etappe dienten. 1916 ordnete das preußische Kriegsministerium eine Zählung der jüdischen Soldaten an. Jacob Rosenthal untersucht erstmals, wie es zu dieser beispiellosen antisemitischen Maßnahme kam und wie die jüdischen Soldaten, aber auch die jüdische und nichtjüdische Öffentlichkeit im In- und Ausland darauf reagierten. Er zeigt, dass die "Judenzählung" lange Schatten warf. Die Legende von den "jüdischen Drückebergern" hielt sich viele Jahrzehnte lang. Erst 1961 wurde die Zahl der jüdischen Gefallenen - 12 000 - von der Bundesrepublik offiziell bestätigt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Das Kriegsministerium ordnete 1916 eine Judenzählung an
"Als wir jüdischen Frontsoldaten in Reih und Glied mit unseren Kameraden ins Feld zogen, da wähnten wir, aller Klassen- und Glaubenshass, alle religiösen Vorurteile seien getilgt. Wir haben uns getäuscht", klagte 1919 der Vorsitzende des Reichsbunds jüdischer Frontsoldaten, Leo Löwenstein. Die Verbitterung, die hier spürbar wird, war mehr als berechtigt: Im Herbst 1916 hatte das preußische Kriegsministerium eine Zählung der Juden im Heer sowie der aus welchen Gründen auch immer zurückgestellten Kriegsdienstpflichtigen angeordnet. Damit wollte es den Klagen darüber, "dass eine unverhältnismäßig große Anzahl wehrpflichtiger Angehöriger des israelitischen Glaubens vom Heeresdienst befreit sei oder sich von diesem unter allen nur möglichen Vorwänden drücke", Rechnung tragen. Die Behauptung, damit keine "antisemitischen Absichten" zu verfolgen, war angesichts eines latenten Antisemitismus im Offizierskorps allerdings wenig glaubwürdig. Die Judenzählung gehört zu den schwärzesten Kapiteln der Geschichte des Kaiserreichs. Erstmals wurden Angehörige jüdischen Glaubens amtlich anders behandelt als diejenigen der beiden christlichen Konfessionen. Demütigend war auch die Art, wie die statistischen Daten an der Front erhoben wurden. Selbst hochdekorierte Frontsoldaten galten nun als "Drückeberger", wenn sie zeitweise Dienst in der Regimentsschreibstube geleistet hatten. An der Heimatfront ordneten einige Generalkommandos zugleich die erniedrigende "Nachmusterung" bisher zurückgestellter Juden an. Das Ergebnis dieser Statistik belegte angeblich die erhobenen Vorwürfe. Schaute man genauer hin, dann war sie jedoch nichts wert, wollte sie doch "Unverhältnismäßiges" feststellen, ohne zu definieren, was "verhältnismäßig" war.
Die Daten, die die jüdische Gemeinschaft zur Verteidigung vor eventuellen Vorwürfen bereits seit Kriegsbeginn erhoben hatte und die mit denen der Forschung weitgehend übereinstimmen, zeichnen zudem ein anderes Bild: Von 550 000 Juden waren 96 000 eingezogen worden beziehungsweise hatten sich freiwillig gemeldet - 77 Prozent davon kämpften an vorderster Front, 30 000 waren ausgezeichnet und 20 000 befördert worden. Prozentual entsprachen diese Daten denjenigen der nichtjüdischen Bevölkerung: Sie kämpften und starben genauso zahlreich wie diese. Nicht zuletzt aus Sorge, die Juden könnten sich weigern, die Kriegsanleihen zu zeichnen, veröffentlichte das Kriegsministerium seine abweichenden Daten nicht. Proteste hochdekorierter jüdischer Frontsoldaten im Reichstag machten deutlich, auf welch gefährlichen Pfad es sich begeben hatte. Bereits in den ersten Kriegstagen war mit Ludwig Frank ein führender Sozialdemokrat jüdischen Glaubens für "Gott, König und Vaterland" gefallen, und zwölftausend weitere Glaubensgenossen folgten ihm.
Jacob Rosenthal, der 1939 nach Palästina emigrieren musste, hat die eigene Familiengeschichte - sein Vater war Oberleutnant der Feldartillerie - zum Anlass genommen, die Wiederherstellung der "Ehre des jüdischen Soldaten" im historischen Längsschnitt darzustellen. Die Judenzählung bezeichnet er treffend als das Ende des "Burgfriedens" und den Beginn eines fatalen Weges: Während die Juden sich gedemütigt fühlten, sahen sich ihre Gegner in ihrem Antisemitismus bestätigt. Die einschlägigen Demagogen zugespielten Zahlen dienten dabei als angeblich unwiderlegbarer Beweis. Die Dolchstoßlegende bereitete nach Deutschlands Niederlage den Boden für immer neue Hetzkampagnen. Trotz ihrer Opfer galten Juden als vaterlandslose Kriegsgewinnler. Selbst die Zahl der gefallenen jüdischen Soldaten war jahrelang Gegenstand eines erbitterten Streits. Nach 1933 wurden ehemalige Frontsoldaten von Angehörigen jenes Vaterlandes, für das sie einst zu sterben bereit waren, genauso vertrieben und ermordet wie ihre Glaubensgenossen. Bundesverteidigungsminister Strauß hat 1961 die Ehre der jüdischen Soldaten wiederhergestellt und ihr Schicksal "als Warnung vor dem Bösen, dem Rassenhass, den modernen totalitären Herrschaftsformen, als Beispiel für Vaterlandsliebe, Leidensfähigkeit und Treue" bezeichnet.
MICHAEL EPKENHANS
Jacob Rosenthal: "Die Ehre des jüdischen Soldaten". Die Judenzählung im Ersten Weltkrieg und ihre Folgen. Campus Verlag, Frankfurt 2007. 227 S., 29,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Mit seiner historischen Untersuchung der 1916 vom Kriegsministerium angeordneten Zählung jüdischer Frontsoldaten beziehungsweise vom Heeresdienst Zurückgestellter und den "Folgen" arbeitet Jacob Rosenthal auch ein Stück eigener Familiengeschichte auf, erklärt Michael Epkenhans. Der Vater des Autors gehörte nämlich selbst zu den 96.000 jüdischen Soldaten, denen mit der "Judenzählung" erstmals von amtlicher Seite unverhohlener Antisemitismus entgegenschlug, so der Rezensent. Er teilt noch mit, dass erst 1961 Verteidigungsminister Franz Josef Strauß die jüdischen Soldaten offiziell rehabilitiert hat, und scheint insgesamt von der Studie angetan zu sein - wenigstens lässt er nichts Gegenteiliges verlauten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH