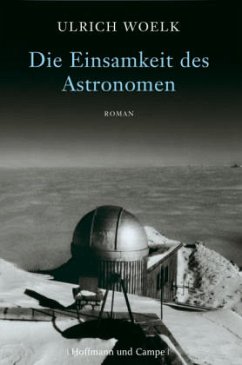So denkt der Astrophysiker Frank Zweig, dem im Jahr nach dem Tod seines Vaters mit Wehmut bewusst wird, dass nichts in seinem Leben von Dauer ist. Da sind Kindheit und Jugend, die im leeren Haus seines Vaters noch einmal lebendig werden und doch unwiederbringlich vorbei sind. Da ist die flüchtige Liebe zu Ellen, die nur momentweise gelingt, oder der Physikerkollege im Observatorium, der auf seiner manischen Suche nach fremder Intelligenz im All den Verstand verliert.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Ulrich Woelk hat Spaß an Gegensätzen, erklärt ein begeisterter Gustav Mechlenburg. Das zeige sich auch in diesem Roman, in dem Woelk, selbst einmal Physiker, das Geschwisterpaar Marthe, ihres Zeichens esoterisch angehauchte Kunstdozentin, und den vernunftliebenden Astrophysiker Frank aufeinanderprallen lässt. So stereotyp und eindeutig allerdings, wie es aus ihren Mündern auch klingen mag, das wird dem Rezensenten allmählich klar, sind die Gegensätze nicht: Nach dem Tod des Vaters erledigt Marthe die Haushaltsauflösung in "grotesk" pragmatischer Weise, indem sie aus dem aufgestapelten Mobiliar des Vaters ein Kunst-Happening macht, während Frank sich schwer tut, mit dem Tod des Vaters fertigzuwerden. Auch angesichts des Zwischenfalls im Observatorium, bei dem ein offensichtlich vom Hauch des Wahnsinns gestreifter Kollege mitten im Schneesturm die Kuppel öffnet und die dort versammelte unbezahlbare technischen Gerätschaft ruiniert, reagiert Frank eher mit Sympathie und Verständnis. "Die Einsamkeit des Astronomen" sieht Mechlenburg als herrliche "Persiflage" des Wissenschaftsromans, der mit Geschick und Komik die "psychoanalytische Offenbarung" liefert, dass sich in der Beobachtung das Beobachtete verändert, auf so intelligente Weise, "dass dem Leser das Teleskop nur so um die Ohren fliegt".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH