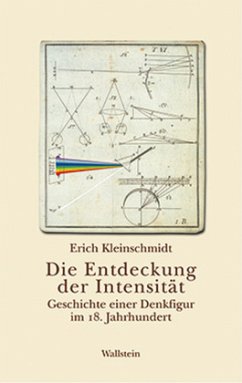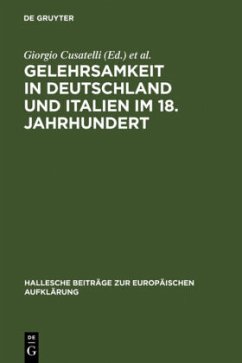Intensität begründet im 18. Jahrhundert ein neues Verständnis, um über gleitende Markierungen zunächst Naturvorgänge, dann aber auch Wahrnehmungsprozesse und schließlich Kulturmodelle zu definieren. Die bisher nicht untersuchte Denkfigur erweist sich als ein Leittheorem in der Formierungsgeschichte einer aufklärerisch initiierten »Moderne«.Am Anfang war das Licht, für dessen Stärke die Naturforschung der Aufklärung einen graduellen Ordnungsbegriff brauchte. Die hierfür erfundene Intensität entwickelt sich rasch und effizient zu einer Denkfigur all jener Bereiche, in denen es um eine gleitende Modellierung geht. Das sind neben den naturwissenschaftlichen Größen von Kraft, Wärme und Licht vor allem die sinnesphysiologischen Wahrnehmungen und die emotionalen Empfindungen. Da diese zu den zentralen Diskursfeldern des 18. Jahrhunderts gehören, erweitert sich der Gebrauch des Begriffs und seines Denkbezirks philosophisch, literaturtheoretisch und kulturpoetisch hochwirksam. Ihre intellektuelle Neuheit, aber auch ihre vielseitige Anwendbarkeit machen Intensität zu einem avancierten Formierungsangebot. Die erstmals umfassend rekonstruierte Geschichte dieser komplexen Begriffsgenese und der daraus entwickelten Intensitätsmodelle gewährt facettenreiche Einblicke in die wissens- und denkgeschichtlichen Umbrüche vor und um 1800. Innovation und Mehrwert des Intensitätsbegriffs bestehen darin, daß dynamische Zustände nicht mehr in einer dualistischen Beschreibungsstruktur stillgestellt werden müssen, sondern daß es möglich ist, zwischen zwei Extremen graduelle Stufen zu markieren. Die Grundlagen dieses Ansatzes gehen auf mathematische Leittheoreme des 18. Jahrhunderts zurück. Philosophen und Literaten ließen sich davon zu intellektuell fruchtbaren Aneignungen anregen. Sie entwickelten ihrerseits Theorien der Intensität. Der Versuch, deren Voraussetzungen und Verzweigungen darzustellen, förderte die Denk- und Ausdrucksmöglichkeiten im Prozeß zur »Moderne«.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Der Literaturwissenschaftler Erich Kleinschmidt begibt sich in diesem Buch auf die Suche nach der Geschichte des Begriffs der Intensität. Es geht ihm dabei der eigenen Erklärung zufolge um die "wissenschaftspolitische Leistungskraft einer offenen 'Denkfigur'", erklärt Rezensent Friedrich Wilhelm Graf. Der Terminus "Intensität" taucht auf im "Kontext der physikalischen Debatten über Temperatur und Licht" und wandert dann hinüber in andere Disziplinen, wo er für Vorstellungen von "Prozessualität" und Übergängen gebraucht wird. Das ist alles nicht uninteressant, meint Graf, so ganz begreiflich findet er den engen Horizont der Darstellung allerdings nicht. Die Untersuchung bleibe im wesentlichen auf "Belege aus den Texte der deutschen Klassiker" beschränkt, auf "Höhenkammliteratur". Die von Historikern geleistete Arbeit - Graf nennt insbesondere Koselleck - ignoriere der Literaturwissenschaftler Kleinschmidt souverän. Das ist dem Rezensenten in jedem Fall ein bisschen zu wenig Extension, wenngleich es der Intensität der Darstellung am Ende vielleicht doch zugute komme.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH