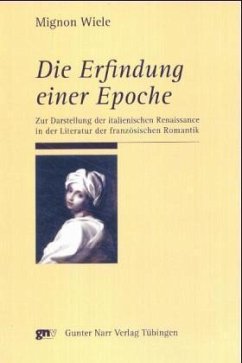Das Bild der italienischen Renaissance in der französischen LiteraturgeschichteDie Genese des Epochenkonzepts "Renaissance", das in den kulturgeschichtlichen Arbeiten Michelets, Burckhardts, Taines und Nietzsches seine Vollendung und terminologische FestSetzung erfährt, vollzieht sich in weiten Teilen bereits in der französischen Literatur der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Zuge der postrevolutionären Geschichtsbegeisterung gewinnt das Bild der italienischen Renaissance in AuseinanderSetzung mit den politischen, sozialen und ästhetischen Umwälzungen der Gegenwart insbesondere in Texten der zweiten romantischen Generation an Kontur. Ausgehend von methodischen Überlegungen zur kulturellen Repräsentation von Geschichte und zum italo-französischen Kulturtransfer widmet sich die Studie diesem bisher wenig beachteten Kapitel der französischen Literaturgeschichte. Interpretative Schwerpunkte bilden dabei die passion italienne, die ästhetisierte Darstellung von Gewalt und Grausamkeit sowie die Vorstellung künstlerischer Perfektion, die als zentrale Topoi des literarischen Renaissancemythos auszumachen sind.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.