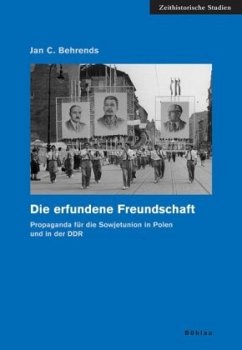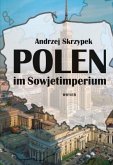Zu den machtpolitischen Instrumenten kommunistischer Herrschaft zählten neben Repression und Gewalt auch Maßnahmen der Erziehung und Propaganda. Vor dem Hintergrund eines historisch belasteten Verhältnisses zu Russland mussten die kommunistischen Regime Osteuropas nach Kriegsende versuchen, ihrer Bevölkerung die enge Bindung an die UdSSR zu vermitteln. Die Freundschaftspropaganda für die Sowjetunion in Polen und Ostdeutschland steht im Zentrum dieser Studie. In transnationaler Perspektive werden die Strukturen der Staaten sowie der Diskurs und die gesellschaftliche Rezeption von Propaganda untersucht. Insbesondere betrachtet der Autor dabei die Rede über die Sowjetunion, die "Erfindung der Freundschaft" in den vierziger Jahren sowie den Führerkult um Stalin und fragt abschließend nach der Wirkungsmacht von Propaganda in der kommunistischen Diktatur.
Zu den Instrumenten kommunistischer Herrschaft zählten neben Repression und Gewalt auch Erziehung und Propaganda. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die im Stalinismus ausgebildeten Herrschaftspraktiken nach Ostmitteleuropa transferiert. Vor dem Hintergrund eines historisch belasteten Verhältnisses zu Rußland versuchten die Staatsparteien in Polen und in der DDR, ihre Bevölkerung für die enge Bindung an die UdSSR zu gewinnen und für die Sowjetisierung zu mobilisieren. Diese Freundschaftspropaganda für die Sowjetunion steht im Zentrum der Studie. In transnationaler Perspektive werden die parteistaatlichen Apparate, der Herrschaftsdiskurs, die Strukturen der Öffentlichkeit und die gesellschaftliche Rezeption der Propaganda untersucht. Der Autor analysiert insbesondere die Rede über die Sowjetunion, die »Erfindung der Freundschaft« in den vierziger Jahren, den Führerkult um Stalin und die Herrschaftskrisen der Jahre 1953 und 1956. Abschließend fragt er nach der Wirkungsmacht von Propaganda in der kommunistischen Diktatur.
Zu den Instrumenten kommunistischer Herrschaft zählten neben Repression und Gewalt auch Erziehung und Propaganda. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die im Stalinismus ausgebildeten Herrschaftspraktiken nach Ostmitteleuropa transferiert. Vor dem Hintergrund eines historisch belasteten Verhältnisses zu Rußland versuchten die Staatsparteien in Polen und in der DDR, ihre Bevölkerung für die enge Bindung an die UdSSR zu gewinnen und für die Sowjetisierung zu mobilisieren. Diese Freundschaftspropaganda für die Sowjetunion steht im Zentrum der Studie. In transnationaler Perspektive werden die parteistaatlichen Apparate, der Herrschaftsdiskurs, die Strukturen der Öffentlichkeit und die gesellschaftliche Rezeption der Propaganda untersucht. Der Autor analysiert insbesondere die Rede über die Sowjetunion, die »Erfindung der Freundschaft« in den vierziger Jahren, den Führerkult um Stalin und die Herrschaftskrisen der Jahre 1953 und 1956. Abschließend fragt er nach der Wirkungsmacht von Propaganda in der kommunistischen Diktatur.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Hermann Wentker hat die Studie über die Freundschaftspropaganda, mit der die Sowjetunion die Verbindung und ihren Machtanspruch gegenüber Polen und der SBZ bzw. der DDR zwischen 1944 und 1957 zu sichern suchten, mit Interesse gelesen. Wenn er den Begriff "utopische Sowjetisierung", den der Autor Jan C. Behrends einführt und mit dem er eine zweite Phase der Indoktrination der Völkerfreundschaft beschreibt, nicht glücklich gewählt findet und auch die allzu sehr detaillierte Darstellung der praktischen Umsetzung dieser Freundschaft zu Stalins 70. Geburtstag kritisiert, so scheint er insgesamt doch recht angetan zu sein. Behrends kann mit seiner Studie zeigen, dass sich die Freundschaftspropaganda in Polen und Deutschland kaum unterschied, stellt Wentker fest und hat offenbar auch hier nichts einzuwenden.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH