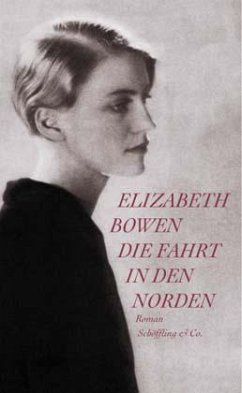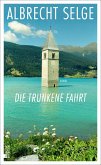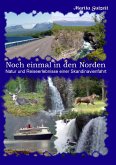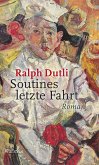Zwei Frauen, die gerade verwitwete Cecilia und ihre Schwägerin Emmeline, teilen sich in den Zwanziger Jahren eine Wohnung in London. Cecilia ist kapriziös und unfähig, jemanden zu lieben. Träge gleitet sie in ihre zweite Ehe mit dem sanften, leidenschaftslosen Julian. Emmeline hingegen, liebenswürdig und unabhängig, muß zu ihrem Erstaunen feststellen, daß sie sich von dem schillernden, etwas windigen Markie angezogen fühlt, der ihr ruhiges Dahinleben durcheinanderbringt. Zuerst akzeptiert sie ihre Affäre, für die Markie die Regeln aufgestellt hat, doch in ihrem Schmerz mißverstanden zu sein, reagiert sie mit Gewalt.

Euphorie der Schnelligkeit, zur Raserei gesteigert: Elizabeth Bowens Meisterwerk der englischen Moderne / Von Tobias Döring
Es müssen schlimme Zeiten sein, wenn der Verkehrsminister beinahe täglich von Verzögerungen und Verspätung redet. Verkehr duldet keinen Aufschub, Verkehr muß fließen, und zwar schnell. Egal ob mit dem Auto, Flugzeug oder Zug, meistens wollen wir doch eigentlich nur schleunigst unterwegs sein. Verkehrsmittel sind, wie ihr Name schon sagt, Mittel zum Zweck. Aber zu welchem?
Natürlich nicht einfach zum Ankommen - das mögen allenfalls beamtete Abteilungsleiter im Verkehrsministerium meinen, wenn sie Beförderungsfälle verwalten. Wir aber wissen, Ankunft ist Stillstand und damit Ende aller Bewegung. Denn seit die Moderne so richtig in Fahrt kam, erzählt uns ihre Literatur von den Entdeckungen der Schnelligkeit, vom Rausch der Beschleunigung und dem gefährlichen Faszinosum des alles durchkreuzenden Verkehrs. Ob Manhattan, London oder Berlin, die Hauptstädte des zwanzigsten Jahrhunderts sind Durchgangsorte, denen das Beschauliche durch Elektrifizierung ausgetrieben worden ist. Selbst der Berliner Alexanderplatz, von dem Döblins Roman sich seinen Titel borgt, war damals keine betonierte Fußgängerödnis, sondern ein Umsteigebahnhof im Umbau, wo die Elektrische rast und die Wuchtbrumme ständig neue Schienen in den Boden rammt. Wenn es denn stimmt, daß wir im Raum die Zeit lesen, dann lesen wir in den Geschichten solcher Raumdurchquerung die Epoche.
Davon erzählt Elizabeth Bowens Roman "Die Fahrt nach Norden", ein rasantes, mehr noch: ein subtiles Meisterverkehrswerk der englischen Moderne. Sein Interesse gilt ganz dem gesellschaftlichen Verkehr, zumal zwischen den Geschlechtern. Seine erstaunliche Energie aber zieht dieser Roman aus den mondänen Transportleistungen, die er feiert. 1932 erschienen, borgt er schon den Titel "To the North" von einem Verkehrsschild. Den Anfang bildet eine lange, schicksalshafte Zugreise, das Ende eine nächtliche Autofahrt, auf der sich die Euphorie der Schnelligkeit zu fataler Raserei steigert. Die stärksten Glücksmomente gönnt er den Figuren nicht etwa im Salon oder Landhaus, sondern während einer Flugreise, obwohl ihnen dort das irre Dröhnen der Propeller nur schriftliche Verständigung erlaubt. Nervös, in betäubender Bewegung und wie vibrierend ist die gesamte Londoner Gesellschaftswelt, die hier geschildert wird. Und das Erstaunlichste dabei: Im Zentrum stehen Frauen, und sie sind es, nicht etwa die eher aufhaltsamen Männer, die den Verkehr vorantreiben.
Zwei Schwägerinnen um die dreißig, die eine jung und wohlhabend verwitwet, die andere erfolgreiche Geschäftsfrau, Inhaberin eines Reisebüros für Individualisten und darauf spezialisiert, ihren Kunden im Urlaub jenes Element der Ungewißheit zu verschaffen, das uns die Großstadtzivilisation ansonsten raubt. Doch die eigentlichen Abenteuer, das wird schnell klar, brechen ungeplant herein und zersetzen die Fassade der gediegenen Alltäglichkeit. Die beiden Frauen wohnen im schicken Londoner Nordwesten an der verkehrsreichen Abbey Road, lange bevor dort Zebrastreifen für bärtige Fußgänger eingerichtet wurden. Ihr Haus wird Durchgangsstation einer alternden Jeunesse dorée. Man sieht sich, trifft sich, traut sich, liebt sich wohl auch mal und trennt sich lieber wieder. Die männliche Bekanntschaft, obschon mit gutem Einkommen, Automobil und tadellosem Anzug ausgestattet, kann die Posen kraftvoller Verführung kaum mehr meistern. Auch Dandys kommen eben in die Jahre und müssen morgens pünktlich zum Bürodienst antreten.
So folgen wir den Partyszenen, Landpartien, Reisen, Flirts und Sherry-Plaudereien. Nichts von all dem interessiert uns wirklich, doch alles fesselt uns daran. Denn dies sind sämtlich nur Momente flüchtiger und trügerischer Ruhe inmitten einer ruhelosen Zeit - und dargeboten werden sie von einer Meisterin der letzten Bannung dessen, was endgültig vergeht. Elizabeth Bowen (1899 bis 1973), vor zwei Jahrzehnten wiederentdeckt als eine Jane Austen der Moderne, stammte aus anglo-irischer Familie und ließ sich erst nach ihrer Heirat dauerhaft in England nieder. Gewiß war es die eigene Mimikry, die der Außenseiterin den Blick für englische Gesellschaftsbiotope so geschärft hat. Wie eine lauernde Insektenfängerin folgt sie allen Figuren, fängt deren Fluchtbewegungen präzise ein und fixiert sie schließlich mit nadelspitzen Worten. Noch die kleinste Randperson erscheint mit einemmal in grellem Licht, das Unerwartetes zum Vorschein bringt. Dazu schreibt Bowen hinreißende, oft aberwitzig komische Dialoge, deren belangloser Inhalt nur das Eigentliche, das sie zum Ausdruck bringen, vielsagend verschweigt.
Hier leistet sich die Übersetzung von Sigrid Ruschmeier zuweilen leider einen allzu flapsigen, saloppen Ton. Sehr viel gelungener sind die Erzählpassagen, in denen der Roman im letzten Viertel unerbittlich seinem Ende zurast. In einem grandiosen Crescendo brechen sich hier verborgene Leidenschaften Bahn: "Ein ungeheures Gefühl von Abfahren und Abschied ergriff von ihr Besitz, wie der lange Pfeil flog sie selbst dahin: Expreßzüge fauchten krachend aus Bahnhöfen, Ozeandampfer legten von Kais ab, Flugzeuge stiegen auf und warfen Schatten, Karawanen verschwanden in der ersten Wüstensenke. Der Reisende, der, allein mit seinen Unsicherheiten und Ängsten, die er nicht mitteilen kann, sieht, wie die Taue, die ihn mit dem Bekannten verbinden, reißen wie Papierbänder, bleibt bei hoher Geschwindigkeit stark und wächst über sich hinaus; der feine Schmerz des Abschiednehmens befreit das Herz."
Der eigentliche Schluß bleibt unerzählt und ist doch so gewiß wie der fatale Stillstand, der auf jede Reise folgt. Unterwegs aber hat uns die Lektüre dieser ungeheuren Abschiedserzählung so nachhaltig bewegt, daß wir in ihrem Windschatten noch lange nicht zu Atem kommen.
Elizabeth Bowen: "Die Fahrt in den Norden". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Sigrid Ruschmeier. Verlag Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2003. 475 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Bewegt bis begeistert zeigt sich Rezensent Tobias Döring von "dieser ungeheuren Abschiedserzählung". Seine erstaunliche Energie sieht der Rezensent diesen Roman, den er auch als "subtiles Meisterverkehrswerk der englischen Moderne" preist, aus den modernen Transportleistungen ziehen, denen er huldige. Die stärksten Glücksmomente nämlich gönne die Autorin ihren Figuren während einer Flugreise. Erstaunlich findet er auch, dass im Zentrum dieser Technik-Apotheose Frauen stehen: Elisabeth Bowens als Jane Austen der Moderne, lesen wir. Im Verlauf der Geschichte folgt Döring den Partieszenen, Landpartien, Reisen, Flirts und Sherry-Plaudereien des Romanpersonals. "Nichts von all dem interessiert uns", gibt er zu Protokoll, "doch alles fesselt uns daran". Denn all das seien sämtlich nur Momente flüchtiger und trügerischer Ruhe inmitten einer ruhelosen Zeit, dargeboten von "einer Meisterin der letzten Bannung dessen, was endgültig vergeht". Bedauerlich findet Döring jedoch, dass sich die Übersetzerin für Bowens "hinreißende, oft aberwitzige Dialoge" leider zuweilen einen allzu flapsigen, saloppen Ton leistet.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"