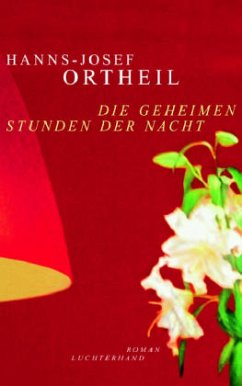Georg von Heuken ist schon fünfzig, als er endlich, nachdem er seit Jahren von diesem Wechsel geträumt hat, die Verlage seines Vaters übernehmen kann. Die nach dem Krieg unbekümmert ihren Erfolg suchende Generation tritt ab und macht widerstrebend Platz. In bewunderswert genauen und ironisch geschliffenen Bildern hat Ortheil diesen Gesellschaftsroman von enormer Dichte geschrieben, hinter dessen Kulissen sich auch eine Liebesgeschichte ereignet. An einem Montagmorgen erhält Georg von Heuken die Nachricht vom zweiten Herzinfarkt seines Vaters, des Großverlegers Reinhard von Heuken. Damit beginnt für ihn, den ältesten Sohn einer alten rheinischen Unternehmer-Dynastie, der Kampf um die Nachfolge und das Erbe des Vaters, der im Krankenhaus liegt und sich an den laufenden Geschäften nicht mehr beteiligen kann. Zum einen hat er es dabei mit seiner Schwester und einem jüngeren Bruder zu tun, die ebenfalls als Verleger im Familienunternehmen tätig sind, zum anderen mit einem gefeierten Autor, einer Agentin, einem Lektor und einem Biographen des Vaters, die den Kampf um die Nachfolge allesamt argwöhnisch verfolgen und mit ihren jeweils eigenen Mitteln versuchen, auf sein Ergebnis Einfluss zu nehmen. Schritt für Schritt arbeitet von Heuken daran, Terrain zu gewinnen, während er unmerklich immer mehr den Wegen und dem Zauber seines übermächtigen Vaters folgt, der in den letzten Jahren vor dem Infarkt ein verborgen gehaltenes nächtliches Zweitleben in einer Suite des Kölner Dom-Hotels führte. Um die Rätsel dieser geheimen Stunden zu erkunden, quartiert sich von Heuken in der Suite ein und entdeckt in sich allmählich Fertigkeiten und Leidenschaften, von denen er sich zuvor nicht einmal hätte träumen lassen, dass sie in ihm schlummern könnten. Hanns-Josef Ortheils neuer großer Roman ist nicht nur ein weit ausholender, virtuos in die Vergangenheit zurückblendender Familienroman, sondern auch das faszinierend aktuelle Panorama unserer Gesellschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts, vor dessen Hintergrund und im Verborgenen der neue Verleger auch in eine Liebesgeschichte hineingezogen wird - zu seinem großen Glück.

Hanns-Josef Ortheils Verlagskomödie / Von Friedmar Apel
Wer in diesen Zeiten der üblen Laune das Positive sucht, der wende sich den Büchern von Hanns-Josef Ortheil zu. Da schreiben nicht unglückliche alternde Schriftsteller an Texten über unglückliche alternde Schriftsteller, da gelingen die Bücher wie das Leben, und die Liebe ist kein Ding der Unmöglichkeit. Sein neuer Roman zeigt ihn auf der Höhe einer Entwicklung, die ihn von biographischem und historistischem Erzählen zur intelligenten Unterhaltungsliteratur und schließlich zur Form des auf Aktualität zielenden Gesellschaftsromans geführt hat.
"Die geheimen Stunden der Nacht" ist eine so detaillierte wie spannende Darstellung des Verlagsgewerbes. Das Thema war nach den das Mythische streifenden Vorgängen um einige deutsche Verlagshäuser wohl fällig. Um es produktiv aufzugreifen aber, braucht es Kenntnisse, und die bezieht Ortheil aus nächster Nähe. So ist das Buch seiner Frau, der Verlegerin Imma Klemm, gewidmet. Der Autor vergißt nicht zu erwähnen, daß sie die Urenkelin des Verlegers Adolf von Kröner ist, der die Buchpreisbindung durchsetzte. Derart ist der Roman auch eine Hommage an die verbliebenen Traditionshäuser und ihre Art des Büchermachens - und ist bestimmt nicht nostalgisch gemeint.
Georg von Heuken, Sohn eines Kölner Verlegers vom knorrigen alten Schlag, ist schon fünfzig Jahre alt, als der zweite Herzinfarkt seines unnahbaren Vaters ihm zunächst schreckhaft die Aussicht eröffnet, den Verlag zu übernehmen. Auf dem Weg dahin muß er seine Schwester Ursula überzeugen und den angeberischen Bruder Christoph ausstechen und sich argwöhnischen Beobachtern innerhalb und außerhalb des Verlages aussetzen, die ihm das Format seines Vaters nicht zutrauen. Die Nagelprobe ist der Umgang mit dem eitlen alten Starautor des Verlags, Wilhelm Hanggartner, der immer für eine Hunderttausender-Auflage gut ist, sein neues Manuskript aber nur dem befreundeten Patriarchen übergeben will. Daß es von Heuken gelingt, Hanggartner den Bauch zu pinseln, ohne aus der Rolle zu fallen, verbucht er als erstes Zeichen wachsender Souveränität.
Trotz der nahenden Buchmesse aber kann er sich nicht nur auf das Geschäft konzentrieren. Es drängt ihn zu erfahren, was sein Vater in der Suite des Domhotels getrieben hat, in der ihn der Infarkt ereilte. Dabei entdeckt er die verborgenen Seiten seines Vaters und zugleich Wünsche und Leidenschaften in sich, die während seiner brav und monogam geführten Ehe jahrzehntelang nicht zutage getreten waren. Schließlich gilt es, sich auch in der Liebe gegen den Vater durchzusetzen. In der Auseinandersetzung mit seiner Herkunft nähert er sich dem Vater immer mehr an und muß feststellen, daß es womöglich gar nicht schlimm ist, so zu werden wie er.
Fast schon didaktisch aufbereitet, erfährt der Leser alles Wichtige über die Buchproduktion - von der Manuskriptbearbeitung über die Autorenpflege bis zu Herstellung und Marketing nebst brancheninternem Jargon und Witz. Das Personal ist vom Lektor über die Agentin bis zur Sekretärin typisch, zugleich aber stattet der Erzähler jede Figur in milder Ironie mit einer individuellen Charakteristik aus, und mit einer Ausnahme werden sie alle früher oder später liebenswert. Das Ganze wird eingebettet in jede Menge Kölner Lokalkolorit mit "Kölsch" und "Krüstchen".
Wie gewohnt läßt Ortheil auch im neuen Roman seiner Lust an der Beschreibung von Orten und Dingen freien Lauf. In der Geschichte wird das aber spezifisch motiviert, indem die Entwicklung des Helden auch als eine des immer wacheren Hinsehens erscheint. So läßt sich das Rheinufer mit der gleichen Intensität schildern wie die Einrichtung eines Hotelzimmers, einen roten Sportwagen der Marke Mazda, einen Floating-Tank, in dem sich Georg von Heuken zu entspannen pflegt, oder ein Kleidungsstück, das die schöne Vorzimmerdame Joana trägt, die der Held mit neuen Augen anschaut. Es "handelt sich um einen eher weiten Blazer aus feiner, im Licht des Deckenstrahlers schimmernder Seide, die anscheinend bemalt ist, die zurückhaltende zwischen Hellgrün und einem Wolkenrosa changierende Bemalung ist aber farblich so geschickt verteilt, daß er keine Knöpfe, Taschen oder andere Details erkennt, all das macht sich vielmehr erst beim zweiten Hinsehen bemerkbar, als er den Blazer auf seine Einzelteile hin betrachtet."
Diese emphatische Hinwendung zur Sichtbarkeit der Welt gehört wesentlich zum optimistischen Gestus des Romans. Der Mensch mag, nach einer gern zitierten Sentenz des alten Verlegers, nur Gast auf Erden sein und unter mancherlei Beschwerden seiner transzendenten Heimat zustreben. Solange er aber wandelt, soll er die weltlichen Dinge in ihrer Schönheit und ihrem Nutzen als die seinen betrachten. So wird die Geschichte hauptsächlich im Präsens erzählt. Die Vergangenheit wirkt zwar als Tradition oder Erinnerung an die Kindheit weiter, sie zählt aber für Georg von Heuken zunehmend nur als vergegenwärtigte, als Spannung des Lebendigen, die ausgehalten und gestaltet werden muß. So entwickelt sich der Held von einem sentimentalen Mitläufer, dessen Blick keinen Halt im Gegenwärtigen findet und der manchmal lieber unsichtbar wäre, zu einem, der heraustritt, hinschaut und handelnd standhält.
So kommt es in dieser Geschichte ganz anders als beim Suhrkamp Verlag, auf den manche Anspielung zielt, und das darf als Plädoyer für die Söhne oder Töchter, für eine natürliche Erbfolge im Verlagswesen gelesen werden, wenngleich auch die Rolle der Ehefrauen nicht unterschätzt wird. Aber Ortheil hat es trotz der unübersehbaren Anspielungen auf Siegfried und Joachim Unseld nicht auf einen publicityträchtigen Schlüsselroman abgesehen. Die Beschreibung des Traditionsverlags "mit seinen mehr als zehn Lektoren und hundert Mitarbeitern", Belletristik und Sachbuch, Reisebücher, Kunst und Fotografie, leiht sich Züge mehrerer bekannter Häuser. Sie bildet das in ironischem Realismus beschriebene Ambiente, in dem sich aktuelle Konflikte wie im Brennspiegel betrachten lassen.
Um so merkwürdiger mutet der offenbar gewollte Stilbruch an, daß der Leser in dem pompösen Starautor des Verlags, Wilhelm Hanggartner, dem Virtuosen der "Preisgabe", der seine "intimsten Passionen" öffentlich ausbreitet und, wenn alles nichts hilft, irgendeinen "abwegigen Kommentar zur Lage der Nation" abgibt, beim besten Willen zur Fiktion eine Karikatur Martin Walsers erkennen muß, auch wenn nicht alle Züge passen. Sie ist freilich nicht ohne Respekt gezeichnet. "Auch bei seinen Lesungen rudert und schaufelt er unablässig mit seiner Rechten, manchmal sieht es so aus, als wolle er seine eigenen Texte entsorgen oder wegkippen wie Schrott, um den sich gefälligst die anderen bemühen sollen. Dennoch, man hört ihm zu, das muß man ihm lassen, er ist nicht einer von jenen Autoren, die ihre Arbeiten so matt vortragen, als hätten sie die Lust an ihnen selbst schon verloren."
Aus der spottlustigen Überzeichnung der Figur zieht Ortheil zum Schluß überdies noch eine hübsche Pointe, indem er seinen Roman so enden läßt, wie es Hanggartner salbadernd vorgibt. So bekennt Ortheil in der Form, daß ihm nichts Walserisches, keine Autoreneitelkeit fremd ist: "Zutiefst zuwider war es mir, meinen Figuren den Laufpaß zu geben, ihnen schnöde das Glück zu entziehen. Als Autor spielt man ja Gott, alle Gesetze des Lebens hat man selbst in der Hand, man kann bestrafen, belohnen, den Rücken kehren, ach, am Ende habe ich meinen Figuren den Rücken gekehrt. Sich abwenden, beiseite gehen, der alte Autoren-Gott trollt sich davon und überläßt das Leben sich selbst, wie findest du das?"
Der positiv gestimmte Leser von Ortheils Roman findet es gut, denn er ist überzeugt, daß Georg von Heuken auch die noch ausstehenden Proben aufs Glück bestehen wird. Daß ein solcher Schluß "marketingtechnisch perfekt" ist, wie der angehende Verleger meint, ist zwar so zweifelhaft wie viele andere branchentypische Phrasen, die im Laufe der Geschichte gedroschen werden, aber das kann dem Leser egal sein. Er fühlt sich von diesem Familien- und Gesellschaftsroman in der Tradition Balzacs bestens belustigt und belehrt.
Hanns-Josef Ortheil: "Die geheimen Stunden der Nacht". Roman. Luchterhand Literaturverlag, München 2005. 382 S., geb., 21,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Ebenso spannend wie detailliert findet Rezensent Friedmar Apel diese Darstellung des Verlagsgewerbes, in der er gleichzeitig eine ganz und gar unnostalgische Hommage an die großen klassischen Verlage und ihre Arbeit erkennt. Hanns-Joseph Ortheil zeigt sich dem Rezensenten darin auf der Höhe seiner Entwicklung. In "ironischem Realismus" und eingebettet in allerlei Lokalkolorit beschreibe Ortheil ein fiktives Kölner Verlagshaus, das in manchem dem Suhrkamp-Verlag nachgebildet sei. Der Autor lässt zur Freude des Rezensenten bei der Beschreibung der Verlegerfamilie und des sie umgebenden Milieus "seiner Lust an der Beschreibung von Orten und Dingen" freien Lauf. Fast schon didaktisch vermittelte Ortheil ihm außerdem wesentliche Kenntnisse der Buchproduktion. Wie im Brennspiegel konnte der Rezensent in diesem Ambiente auch aktuelle Konflikte (etwas den zwischen Unseld Vater und Unseld Sohn) betrachten, ohne dass er je den Eindruck eines Schlüsselromans bekam. Besonders die "nicht ohne Respekt" gezeichnete Karikatur Martin Walsers hat sein Lesevergnügen ausgesprochen positiv beeinflusst. Am Ende fühlte sich der Rezensent wie nach der Lektüre eines Balzac-Romans: "bestens belustigt und belehrt".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Hanns-Josef Ortheil bietet [...] kultivierte Stunden des Wohlbehagens - einen erstklassigen Unterhaltungsroman mit literarischem Anspruch." Neue Zürcher Zeitung