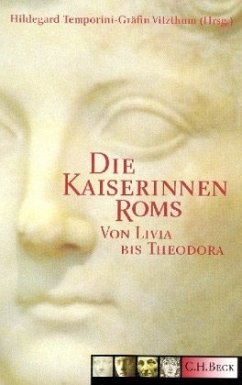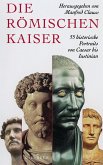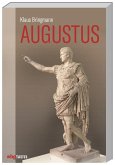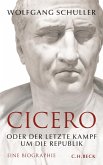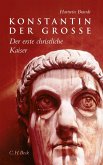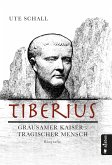Viele der Kaiserinnen Roms ließen sich nicht auf die Rolle der "Frau an seiner Seite" reduzieren. Unter ihnen finden sich sehr unterschiedliche und eigenwillige Persönlichkeiten, deren Charaktere das Spektrum zwischen den Extremen strenger Matronen, machtbewußter "Staatsfrauen" sowie - will man den Quellen glauben - ausschweifender Nymphomaninnen und christlicher Büßerinnen abdecken. Hildegard Temporini-Gräfin Vitzthum und ihre Mitautoren geben sich hier nicht mit den bisweilen wohlfeilen Klischees der Überlieferung zufrieden, sondern rekonstruieren die gesellschaftlichen und politischen Existenzbedingungen ihrer Protagonistinnen. Dabei gehen sie zugleich den Absichten derer auf den Grund, die das Bild der jeweiligen Herrscherin in der Geschichte gestaltet haben. Denn natürlich war deren Darstellung von Interessen geleitet - konnte doch beispielsweise ein unliebsamer Kaiser sehr bequem über den an seine Frau gerichteten Tadel, sich ehebrecherisch oder machtgierig zu verhalten, diskreditiert werden. Und ebenso schmückte man die Gattin eines "guten" Herrschers nur allzu bereitwillig mit positiv bewerteten Fraueneigenschaften. Dieses reich bebilderte und allgemeinverständliche Werk erschließt erstmals über fünfhundert Jahre römischer Geschichte aus dem Blickwinkel der Herrscherinnen. Die Beiträger Bruno Bleckmann (Universität Bern); Helmut Castritius (Technische Universität Braunschweig); Manfred Clauss und Hartmut Leppin (Universität Frankfurt/ Main); Werner Eck (Universität zu Köln); Hildegard Temporini-Gräfin Vitzthum (Universität Tübingen).
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Etwas übernommen haben sich Hildegard Temporini-Gräfin Vitzthum und ihre Mitautoren mit ihrem Anliegen, einen umfassenden Überblick der römischen Kaiserfrauen von den Anfängen bis in die Spätantike und daraus resultierend eine Neubewertung der römischen Geschichte zu liefern, konstatiert Rezensent Burkhard Reitz. Die zahlreichen Biografien von Kaiserinnen bieten zwar so manches interessante Detail, meint Reitz, historische und kulturelle Zusammenhänge blieben aber im Dunkeln. Die Autoren haben seiner Meinung nach zu viel Wert auf eine chronologische Erzählweise gelegt, ohne zum Beispiel zeitgenössische Konzeptionen von weiblicher Macht oder vorherrschende Frauenbilder in die Analyse mit einfließen zu lassen. Frauen waren damals nur "aktiv am Machtgeschehen beteiligt, wenn die männliche Führung schwach, krank oder tot war", resümiert der Rezensent seinen Erkenntnisgewinn und hätte sich eine Analyse gewünscht, die über diese reine Beschreibung hinaus geht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH